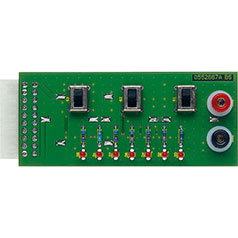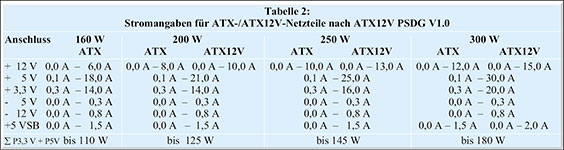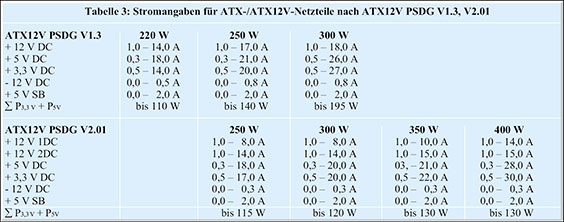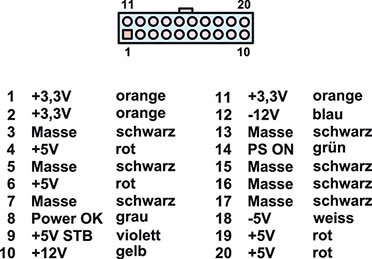Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR
ATX-Netzteil-Tester
Aus ELVjournal
05/2005
0 Kommentare
Technische Daten
| Anzeigen | 7 Leuchtdioden |
| Vorlast +3,3 V | 330 mA |
| Vorlast +5 V | 333 mA |
| Vorlast +12 V | 1,03 A |
| Anschluss | 20-Pin-Mainboard-Steckverbinder |
| Max. Betriebsdauer | 5 Minuten |
| Abmessungen (B x H x T) | 135 x 50 x 75 mm |
| Multimeteranschluss zur Überprüfung | |
Mit
diesem kleinen Testgerät kann die Funktion von ATX-Computer-Netzteilen
schnell überprüft werden. LEDs zeigen alle vorhandenen Spannungen an,
und ein zusätzlicher Multimeteranschluss erlaubt auch die Überprüfung
der jeweiligen Toleranzen.Allgemeines
Der
ATX-Netzteil-Tester ist ein Beispiel dafür, dass einfache,
unkomplizierte Schaltungen oft einen sehr hohen Nutzen haben und u. U.
eine Fehlersuche wesentlich vereinfachen können. Die Überprüfung, ob ein
ATX-PC-Netzteil grundsätzlich funktioniert, ist in wenigen Sekunden
erledigt. Ohne ein entsprechendes Netzteil arbeitet kein Computer, und
oft liegt es an der Spannungsversorgung, wenn ein System plötzlich
instabil läuft. Neben einem Defekt kommt es häufig zur Überlastung von
Computer-Netzteilen, wenn weitere Komponenten eingebaut oder bestehende
Komponenten durch leistungsfähigere ersetzt werden. Eine schnellere
Festplatte oder eine leistungsfähigere 3D-Grafikkarte kann erheblich
mehr Energie benötigen als die bisher verwendeten Baugruppen.Die
Gesamt-Leistungsaufnahme aus dem PC-Netzteil ist dabei nicht unbedingt
ausschlaggebend, vielmehr muss sichergestellt sein, dass die einzelnen
Spannungszweige nicht überlastet werden. Entsprechend der
ATX-Spezifikation liefern alle ATX-PC-Netzteile die Spannungen +3,3 V,
+5 V, + 12 V, -5 V und -12 V. Des Weiteren steht eine Stand-by-Spannung
von 5 V ständig, auch bei ausgeschaltetem Gerät, zur Verfügung. Die
Belastbarkeit ist je nach Leistungsklasse des Netzteils unterschiedlich.
Häufig wird die Maximalleistung des +3,3-V und des 5-V-Zweiges als
„Combined Power“
zusammengefasst. Welcher Spannungszweig nun wie stark belastet wird, ist
abhängig von den verwendeten Komponenten und vom eingesetzten
Prozessorsystem. Während beim Pentium-4-System die 12-V-Spannung stark
belastet wird, erfordern AMD-Prozessoren eine höhere Belastbarkeit im
„Combined Power“-Zweig. Der zur Verfügung stehende Strom bei dem am
stärksten belasteten Ausgang ist wesentlich wichtiger als die zur
Verfügung stehende Gesamtleistung des Netzteils. Üblicherweise ist auf
dem Typenschild des Netzteils die maximal zulässige Belastung der
einzelnen Spannungszweige angegeben. Sehr wichtig sind natürlich die
Spannungen +3,3 V, +5 V und +12 V, da neben dem Mainboard auch alle
Steckkarten und Laufwerke damit versorgt werden. Spannungsabfälle können
zu Instabilitäten führen oder Fehler verursachen, die nur schwer zu
lokalisieren sind. Die
zulässigen Toleranzen der einzelnen Versorgungs- spannungen sind in
Tabelle 1 zu sehen. Die bei verschiedenen Netzteilleistungen zur
Verfügung stehenden Ströme nach älterer ATX- bzw. ATX12V-Spezifikation Die
bei verschiedenen Netzteilleistungen zur Verfügung stehenden Ströme
nach älterer ATX- bzw. ATX12V-Spezifikation (Power Supply Design Guide
v1.0) sind Tabelle 2 zu entnehmen. Zum
Betrieb dieser Netzteile ist ausschließlich eine Mindestlast im 3,3-V-
und im 5-V-Zweig vorgeschrieben. Tabelle 3 zeigt, welche Ströme
Netzteile liefern müssen, die nach der ATXSpezifikation v1.3 bzw. v2.01
gebaut sind. Netzteile
nach ATX12V PSDG v2.01 sind hauptsächlich für Mainboards mit
Pentium-4-Prozessor konzipiert. Diese Netzteile können im 12-V-Zweig
wesentlich höhere Ströme liefern. Zu bedenken ist allerdings, dass bei
diesen Netzteilen auch im 12-V-Bereich eine Mindestlast zum sicheren
Betrieb erforderlich ist. Ältere Netzteiltypen haben diese Forderung
nicht. Neben den bereits beschriebenen Spannungen liefern ATX-Netzteile
zusätzlich eine Stand-by-Spannung von 5 V, die das Mainboard auch bei
ausgeschaltetem PC versorgt. ATX-PCs werden über einen Taster ein- und
ausgeschaltet, wobei das Netzteil durch ein PS-on-Signal vom Mainboard
aktiviert wird. Einige Geräte können mit einem zusätzlichen Netzschalter
direkt am Netzteil auch vollständig vom Netz getrennt werden.Laut
Spezifikation müssen ATX-Netzteile mit mehreren verschiedenen
Steckverbindungen ausgestattet sein. Zur Verbindung mit dem Mainboard
dient dabei ein 20-poliger bzw. bei neueren Modellen ein 24-poliger
Kabelstecker (Abbildung 1), dessen Pin-Belegung in Abbildung 2 zu sehen
ist. 
|
| Bild 1: 20-poliger bzw. 24-poliger Kabelstecker |
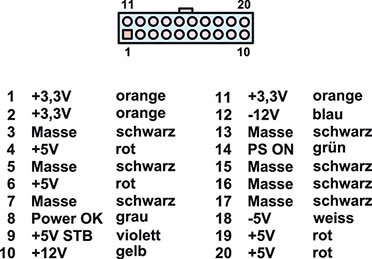
|
| Bild 2: Pin-Belegung des ATX-Mainboard- Steckverbinders |

|
| Bild 3: 12-V-Stecker mit 4 Pins |
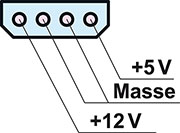
|
| Bild 4: Festplatten-Steckverbinder |
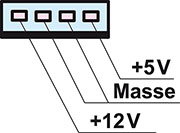
|
| Bild 5: Laufwerk-Steckverbinder |
Bedienung und Funktion
Der
ATX-Netzteil-Tester wird am Haupt- Mainboard-Kabelstecker des zu
prüfenden Netzteils angeschlossen und gibt in wenigen Sekunden
Aufschluss über die grundsätzliche Funktion des Prüflings. Solange sich
der rechte Schiebeschalter des Netzteil-Testers in der unteren Position
befindet, ist das Netzteil deaktiviert, d. h. ausschließlich die
Stand-by-Spannung von 5 V muss vorhanden sein und die entsprechende
Leuchtdiode (+5 V STB) am Tester muss aufleuchten. Zur genauen
Überprüfung der Spannungstoleranzen kann an den 4-mm-Messgerätebuchsen
ein beliebiges Multimeter angeschlossen werden. In der mittleren
Schalterstellung des Powerschalters (S 1) wird dann die
Stand-by-Spannung zum Multimeter durchgeschaltet, wobei das Netzteil
gleichzeitig eingeschaltet wird. In der obersten Schalterstellung des
Powerschalters können alle weiteren Netzteilspannungen mit Hilfe des
angeschlossenen Multimeters überprüft werden. Das grundsätzliche
Vorhandensein der einzelnen Spannungen wird mit Hilfe der zugehörigen
Leuchtdioden angezeigt. Die Ausgänge +3,3 V, +5 V und +12 V werden vom
ATX-Netzteil-Tester mit dem jeweils erforderlichen Mindeststrom
belastet. Aufgrund der dadurch entstehenden Verlustleistung im Bereich
der Hochlastwiderstände ist kein Dauerbetrieb zulässig. Die maximale
Betriebsdauer beträgt 5 Minuten. Danach ist jeweils eine Abkühlphase
erforderlich. Die Auswahl der mit dem Multimeter zu überprüfenden
Spannungen erfolgt mit den beiden linken Schiebeschaltern.Schaltung
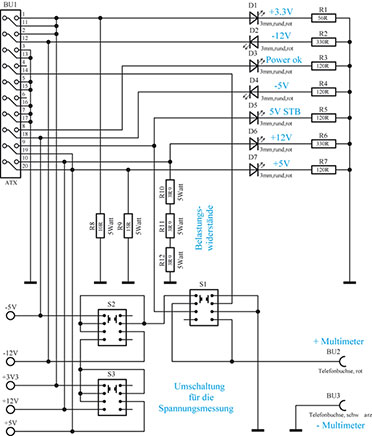
|
| Bild 6: Schaltbild des ATX-Netzteil-Testers |
Nachbau
Da
beim ELV-ATX-Netzteil-Tester ausschließlich bedrahtete konventionelle
Bauteile zum Einsatz kommen, ist der praktische Aufbau des Gerätes
besonders einfach und schnell erledigt. Zum Einsatz kommt eine
doppelseitig durchkontaktierte Leiterplatte, so dass keine Drahtbrücken
erforderlich sind. Zuerst werden die Metallfilmwiderstände R 1 bis R 7
auf Rastermaß abgewinkelt, von oben durch die zugehörigen
Platinenbohrungen geführt und an der Platinenunterseite leicht
angewinkelt, damit die Bauteile nach dem Umdrehen der Platine nicht
wieder herausfallen können. Danach ist die Platine umzudrehen, und alle
Widerstände sind in einem Arbeitsgang zu verlöten. Die überstehenden
Drahtenden werden direkt oberhalb der Lötstellen abgeschnitten, ohne die
Lötstellen selbst zu beschädigen. Im nächsten Arbeitsschritt sind die
drei Schiebeschalter einzubauen. Es ist dabei unbedingt darauf zu
achten, dass die Schaltergehäuse vor dem Verlöten plan auf der
Platinenoberfläche aufliegen. Dann sind die Leuchtdioden an der Reihe,
wobei hier auf die korrekte Polarität zu achten ist. Zur Kennzeichnung
verfügt die Anode grundsätzlich über einen längeren Anschluss, und im
Bestückungsdruck ist die Anodenseite mit einem Plus-Symbol
gekennzeichnet. Die LEDs benötigen eine Einbauhöhe von 11 mm, gemessen
von der LED-Spitze bis zur Platinenoberfläche. Auch hier sind an der
Platinenunterseite die überstehenden Drahtenden sorgfältig
abzuschneiden. Weiter geht es nun mit dem 20-poligen Steckverbinder BU
1, der von der Platinenunterseite zu bestücken ist. Wenn das
Buchsengehäuse plan auf der Platine aufliegt, sind an der Oberseite alle
Anschlusspins
|
| Bild 7: So müssen die Anschlüsse bei den Hochlastwiderständen abgewinkelt werden |
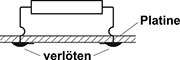
|
| Bild 8: Einbau der Hochlastwiderstände |

|
| Bild 9: Einschub der Fixierungsplatine in die Führungsnuten |
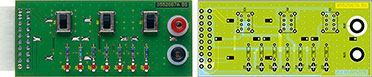
|
| Ansicht der fertig bestückten Platine des ATX-Netzteil-Testers mit zugehörigem Bestückungsplan von der Bestückungsseite |

|
| Ansicht der fertig bestückten Platine des ATX-Netzteil-Testers mit zugehörigem Bestückungsplan von der Lötseite |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (5 Seiten)
als PDF (5 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- ATX-Netzteil-Tester
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo





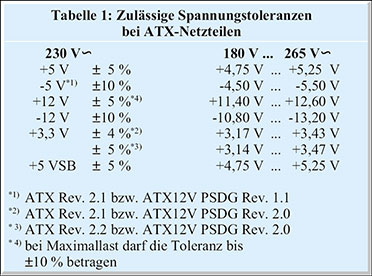

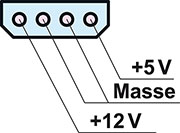
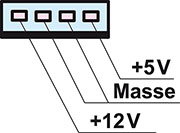
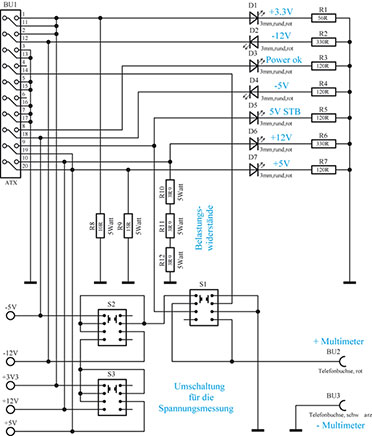

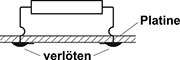

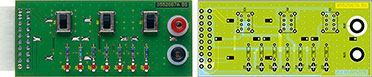

 als Online-Version
als Online-Version als PDF (5 Seiten)
als PDF (5 Seiten)