Akku-Einzelzellen-Tester HET 20 Teil 2/2
Mit
dem HET 20 ist die Kapazitätsmessung von Einzelzellen mit bis zu 20 A
Entladestrom und somit unter realistischen Einsatzbedingungen möglich.
Unterstützt werden alle wichtigen Akku-Technologien wie NC, NiMH,
Blei-Säure, Blei-Gel, Lithium-Ionen und Lithium-Polymer.Nachbau
Beim
HET 20 kommen sowohl konventionelle bedrahtete Bauelemente als auch
SMD-Bauteile zum Einsatz. Besonders einfach wird der praktische Aufbau
dadurch, dass die Leiterplatte mit komplett bestückten SMD-Komponenten
ausgeliefert wird. Aufgrund der Miniatur-Bauweise und der geringen
Pin-Abstände, insbesondere beim Mikrocontroller, wird die Handbestückung
der SMD-Komponenten sonst zu schwierig. Zu leicht können dabei
Kurzschlüsse zwischen benachbarten ICPins entstehen.Das
für 2 x 16 Zeichen ausgelegte Punktmatrix- LCD-Modul mit
Hinterleuchtung wird anschlussfertig als komplett aufgebaute Einheit
geliefert. Da von Hand nur noch die konventionell bedrahteten Bauteile
wie Taster, Buchsen usw. zu bestücken sind, entsteht in recht kurzer
Zeit ein fertig aufgebautes Gerät. Wie
bereits im ersten Teil des Artikels erwähnt, gibt es zwei
unterschiedliche Montagemöglichkeiten für die Displayeinheit, wodurch
der Einbau in ein Gehäuse sehr flexibel möglich ist. Bei liegender
Displaymontage bleibt die Basisplatine als eine große Einheit bestehen.
Soll hingegen das Display in stehender Position genutzt werden, besteht
die Möglichkeit, die Platine entlang der Sollbruchstelle in zwei Hälften
zu brechen. Damit aber keine Bauteile beschädigt werden, sollte das
Brechen der Platinen entlang der Sollbruchstelle vor der weiteren
Bestückung mit Bauteilen erfolgen. Die Displayeinheit mit den
Bedientasten wird dann nach der Bestückung mit Hilfe von zwei
Montagewinkeln rechtwinklig an die Hauptplatine geschraubt, und alle
korrespondierenden Leiterbahnen sind mit viel Lötzinn zu verbinden. Im
weiteren Verlauf der Nachbaubeschreibung gehen wir von der zweiten
Variante (Display und Bedientaster im 90°-Winkel zur Hauptplatine
montiert) aus, wobei die Bestückung ansonsten identisch ist. Die
eigentlichen Bestückungsarbeiten beginnen wir mit dem Einlöten des
Widerstandes R 8 in stehender Position. Es folgen die
Elektrolyt-Kondensatoren, wobei unbedingt die korrekte Polarität zu
beachten ist. Falsch gepolte Elkos können sogar explodieren.
Üblicherweise ist die Polarität bei Elkos am Minuspol gekennzeichnet.
Nach dem Einlöten sind, wie auch bei allen danach zu bestückenden
bedrahteten Bauelementen, die überstehenden Drahtenden mit einem
scharfen Seitenschneider direkt oberhalb der Lötstellen abzuschneiden. Im
nächsten Arbeitsschritt ist der Einstelltrimmer R 1 einzulöten, wobei
eine zu große oder zu lange Hitzeeinwirkung auf das Bauteil zu vermeiden
ist. Der aus zwei Hälften bestehende Platinen- Sicherungshalter wird
gleich nach dem Einlöten mit der dazugehörenden Glas- Feinsicherung
bestückt. Mit einer Senkkopfschraube M3 x 12 mm, Zahnscheibe und Mutter
wird der Kfz- Sicherungshalter auf die Leiterplatte montiert, und
anschließend sind die Anschlüsse mit viel Lötzinn festzusetzen. Danach
ist die 25-A-Kfz-Sicherung in den Sicherungshalter zu drücken. Es
folgt der Einbau des Spannungsreglers IC 4 mit möglichst kurzen
Anschlussbeinchen. Die Western-Modular-Buchse BU 2 und die DC-Buchse BU 1
müssen vor dem Verlöten plan auf der Platinenoberfläche aufliegen. Die
Shunt-Widerstände R 27 und R 28 sind aus Manganindrahtabschnitten von 58
mm Länge herzustellen. Über die beiden Manganindrahtabschnitte ist
jeweils ein 53 mm langer Isolierschlauch zu ziehen, bevor die
Widerstände in einem Bogen nach oben in die Leiterplatte gelötet werden. Nach
dem Einlöten müssen jeweils 53 mm Länge des Widerstands-Drahtes wirksam
bleiben. Zur Wärmeabfuhr wird der Leistungstransistor T 7 an einen
großflächigen Kühlkörper montiert. Da die Kühlfahne des Transistors
gegenüber dem Kühlkörper isoliert werden muss, sind eine Glimmerscheibe
und eine Isolierbuchse erforderlich. Die Glimmerscheibe wird zur
Verringerung des Wärme-Übergangswiderstandes beidseitig dünn mit
Wärmeleitpaste bestrichen. Danach erfolgt die Montage mit einer Schraube
M3 x 10 mm, Zahnscheibe und Mutter am Kühlkörper. Zur
Befestigung des Temperatursensors SAX 1 dient eine Metallschelle und
eine gewindeschneidende 3-mm-Schraube. Auch der Temperatursensor ist zur
Verringerung des Wärmeübergangswiderstandes an der abgeflachten Seite
dünn mit Wärmeleitpaste zu bestreichen. Danach werden die Anschlüsse des
Leistungstransistors und des Temperatursensors von oben durch die
zugehörigen Platinenbohrungen geführt und der Kühlkörper mit zwei
selbstschneidenden 3-mm-Schrauben fest auf die Leiterplatte montiert. Im
nächsten Arbeitsschritt sind danach die Anschlusspins sorgfältig zu
verlöten. 
|
| Bild 5: LCD-Modul mit angelöteter 16-poliger Stiftleiste |
Der
Abstand des Displaymoduls zur Bedienplatine wird durch vier
Abstandsröllchen von 8 mm Länge bestimmt. Zur Montage sind vier
Schrauben M2 x 14 mm von oben durch die Befestigungsbohrung der
Displayplatine zu führen, die Schraubenenden werden dann jeweils mit
einem Abstandsröhrchen bestückt und durch die zugehörigen Bohrungen der
Bedienplatine geführt. An der Platinenunterseite erfolgt letztendlich
das Verschrauben mit vier Muttern M2, wobei jeweils zwischen die Platine
und die Muttern eine M2-Fächerscheibe zu legen ist. Damit sind die
Leiterplatten bereits vollständig bestückt. Im nächsten Arbeitsschritt
werden die Anschlussleitungen zum Prüfling angefertigt und
angeschlossen. Das Gerät besitzt zum Anschluss an der zu entladenden
Zelle jeweils zwei Leitungen für den Pluspol und zwei Leitungen für den
Minuspol, die direkt an die Anschlusspole des Prüflings anzuschließen
sind. 
|
| Bild 6: Anschluss des HET 20 bei Akkus mit Lötfahne |
Doch
kommen wir nun zur Konfektionierung und zum Anschluss der einzelnen
Leitungen. Dazu werden jeweils eine rote und eine schwarze Leitung von
50 cm Länge mit einem Mindestquerschnitt von 2,5 mm2 und jeweils eine
rote und eine schwarze „Sense“-Leitung gleicher Länge benötigt, bei
denen der Querschnitt eine untergeordnete Rolle spielt. Hier sind dünne
Leitungen mit einem Querschnitt von 0,22 mm2 vorgesehen. Alle freien
Leitungsenden werden auf 6 mm Länge abisoliert, verdrillt und
vorverzinnt. Das Leitungsende der roten Leitung mit 2,5 mm2 Querschnitt
ist von oben durch die Platinenbohrung von ST 1 und das schwarze
Leitungsende mit gleichem Querschnitt durch die Bohrung von ST 4 zu
führen. Mit ausreichend Lötzinn erfolgt dann das Verlöten an der
Platinenunterseite. Die dünnen Sensorleitungen sind an ST 2 (Rot) und ST
3 (Schwarz) anzuschließen. Die Kontaktierung am Prüfling ist abhängig
von den individuellen Einsatzbedingungen. Bei Zellen mit Lötfahne kann
z. B. der Anschluss erfolgen wie in Abbildung 6 gezeigt. Abgleich
Um
genaue Messergebnisse zu erhalten, ist vor der ersten Inbetriebnahme
ein Softwareabgleich durchzuführen. Beim ersten Anlegen der
Betriebsspannung sind noch keine Kalibrierparameter im internen
nicht-flüchtigen Speicher (EEPROM von IC 1) abgelegt. Daher wird nach
der Anzeige „Hochstromentladegerät Version x.x“ (Version zeigt die
aktuelle Firmwareversion des Mikrocontrollers) automatisch der
Kalibriermode aufgerufen. Befinden sich bereits Kalibrierparameter im
EEPROM, wird nach der Initialisierung das Gerät in den normalen
Betriebsmode gehen. Natürlich kann auch jederzeit eine Neukalibrierung
erfolgen. Dazu ist das HET 20 auszuschalten, die Tasten „Anzeige“ und
„Menü“ sind gedrückt zu halten und danach ist die Betriebsspannung
wieder anzulegen. Auf dem Display erscheint nun nach der
Initialisierung, wie zuvor beschrieben, folgende Anzeige:Soll
kein Stromabgleich erfolgen, ist die Taste unterhalb von „Nein“ zu
betätigen. Ohne Veränderungen vorzunehmen, geht das Programm dann zum
Spannungsabgleich. Wird hingegen mit der Taste unterhalb von „Ja“ der
Stromabgleich bestätigt, erfolgt zuerst der Nullpunkt-Abgleich für die
Strommessung. Zum
eigentlichen Abgleich ist bei offenen Anschlussleitungen die Taste
unterhalb von „OK“ kurz zu betätigen. Daraufhin geht das Programm zum
eigentlichen Stromabgleich. Zum
Abgleich ist nun ein Akku (der einen Mindestentladestrom von 5 A
liefern kann) mit in Reihe geschaltetem Amperemeter anzuschließen und
mit Hilfe der Tasten unterhalb der Pfeilsymbole der Entladestrom von 5 A
± 1 % einzustellen. Soll der Abgleich nicht bei 5 A, sondern bei einem
beliebigen anderen Strom erfolgen, ist der gewünschte Stromwert mit
Hilfe der Taste unterhalb von I einzustellen. Sobald die Anzeige des
Multimeters mit dem eingestellten Stromwert übereinstimmt, erfolgt die
Speicherung des Kalibrierwertes mit der Taste OK. Danach geht das
Programm weiter zum Menü Spannungsabgleich. Soll
kein Spannungsabgleich erfolgen, ist die Taste unterhalb von „Nein“
kurz zu betätigen. Das HET 20 geht daraufhin automatisch in den normalen
Betriebsmode über. Wird hingegen mit „Ja“ bestätigt, ruft das Programm
zuerst den Nullpunkt- Abgleich für die Spannungsmessung auf. Zum
Nullpunkt-Abgleich sind alle Anschlussleitungen einfach kurzzuschließen
(besonders die Sense-Leitungen), und mit der Taste unterhalb von „OK“
wird dann der Abgleichwert für den Nullpunkt im EEPROM gespeichert. Das
Programm geht daraufhin zum Spannungsabgleich im oberen Messbereich, der
bei 4 V durchgeführt wird. Sobald
an die Messleitungen eine Spannung von genau 4 V angelegt wird, erfolgt
wieder in gewohnter Weise die Speicherung des Messwertes mit der Taste
unterhalb von „OK“. Der vollständige Abgleich des HET 20 ist damit
bereits abgeschlossen und der normale Betriebsmode wird aufgerufen. Nun
ist das Gerät voll einsatzbereit, und falls gewünscht, kann der Einbau
in ein geeignetes Gehäuse erfolgen. Bei der Gehäuseauswahl ist unbedingt
im Bereich des Kühlkörpers für eine ausreichende Luftkonvektion zu
sorgen. 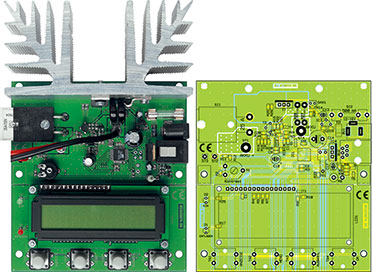
|
| Ansicht der fertig bestückten Platinen des Hochstrom-Entlade- Testgerätes mit zugehörigem Bestückungsplan |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Akku-Einzelzellen-Tester HET 20 Teil 2/2
| weitere Fachbeiträge | Foren | |
Kommentare:
10.05.2013 schrieb Kaspar Hämmerli:
„Suche Bausatz: Akku-Einzelzellen-Tester”
15.05.2013 schrieb Michael Sandhorst (Technik):
„Hallo Kaspar Hämmerli,
im Produktlebeneszyklus müssen unsere Produktmanager an einem gewissen
Punkt entscheiden, ob wir das Sortiment aus vielerlei Gründen (z.B.
Nachfrage, limitierte Lagerkapazität) ändern oder nicht. In diesem Fall
haben die Verantwortlichen eine Auslistung entschieden. Derzeit können
wir Ihnen aus unserem aktuellen Liefersortiment auch keinen Nachfolger
mit gleichen Produkteigenschaften anbieten.
Wir bedauern Ihnen keine andere Mitteilung machen zu können.
Mit freundlichen Grüßen Michael Sandhorst (Technik)”
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo







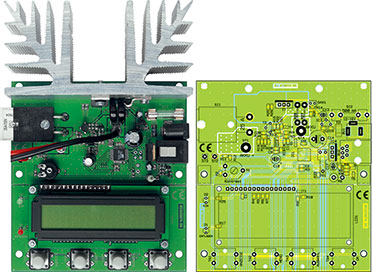
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)