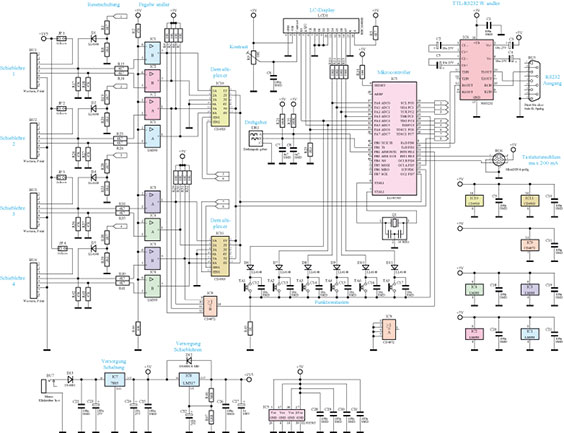Schieblehrenanzeige SLA 1
Aus ELVjournal
06/2005
0 Kommentare
Technische Daten
| Signal-Eingänge | 4 |
| Spannungsversorgung | 9 VDC |
| Stromaufnahme | max. 350 mA |
| PS/2-Tastaturanschluss | max. 200 mA |
| Serielle Schnittstelle | RS232 |
| Abm. (B x H x T) | 167 x 90 x 42 mm |
Die
Schieblehrenanzeige SLA 1 erfasst die Messsignale von bis zu vier
elektronischen Schieblehren und zeigt diese auf einem vierzeiligen
LC-Display an. Dabei können die gemessenen Werte mit anderen Werten
addiert, subtrahiert und multipliziert werden. Weiterhin sind Konstanten
in die Berechnungen einbeziehbar, die man über eine zusätzlich
anschließbare PC-Tastatur besonders komfortabel eingeben kann. Für die
Weiterverarbeitung der ermittelten Daten auf einem PC steht eine
serielle Schnittstelle zur Verfügung.Schnittstelle richtig genutzt
Schieblehren
sind neben den noch genauer anzeigenden Mikrometerschrauben das
klassische Messmittel der Mechanik schlechthin, erlauben sie doch genaue
Außen- wie Innenmessungen sowie reproduzierbare Messungen über die
präzise Feststellfunktion. Schon seit längerer Zeit sind digital
anzeigende Schieblehren Standard für Profis, in den letzten Jahren
erobern diese Digital-Messgeräte zunehmend auch den Markt für
Hobby-Anwender. Die meist auf ein Hundertstel Millimeter genau
anzeigenden Schieblehren können hier oft bereits die klassische und
aufgrund ihrer aufwändigen mechanischen Ausführung immer noch teure
Mikrometerschraube ersetzen. Nahezu alle dieser elektronischen
Schieblehren verfügen über eine Vierdraht- Schnittstelle, die sowohl den
Zugriff auf die Betriebsspannung als auch auf die Messdaten ermöglicht.
Der professionelle Werkzeugmacher/Dreher verfügt zur Nutzung dieser
Schnittstelle oft über einen entsprechenden Schnittstellen-Anschluss an
seiner NC-Einheit. Diese versorgt dann auch u. U. die Schieblehre mit
Betriebsspannung, so dass kein Austausch von Batterien nötig ist. Für
die Auswertung der Messdaten gibt es im professionellen Bereich auch
Stand-alone-Interfaces, die allerdings meist einen direkten Anschluss an
einen PC erfordern – wer hat als Hobby- Anwender den schon in der
Werkstatt stehen? Dennoch ist die Auswertung der Messdaten einer
elektronischen Schieblehre auch für diesen Personenkreis interessant.
Besonders Funktions-Modellbauer, aber auch alle anderen, die der
Feinmechanik frönen, benötigen nicht nur exakte Messergebnisse, diese
müssen auch reproduzierbar sein, und mitunter sind aufwändigere
Berechnungen nötig, die zusätzlich einen Taschenrechner in der Werkstatt
beschäftigen. Und schließlich sind bei komplizierteren Teilen
gleichzeitig mehrere Messdaten zu erfassen und auszuwerten. Genau diesem
Aufgabenbereich entspricht unsere Schieblehrenanzeige SLA 1. Sie kann
zunächst die Messwerte von bis zu vier Schieblehren erfassen und auf
einem vierzeiligen LC-Display anzeigen. Der maximal erfassbare Bereich
beträgt ±999,99 mm. Die Messwerte können untereinander und mit
unterschiedlichen Konstanten verrechnet werden. Dies ist besonders für
den Einsatz an einer Drehbank interessant. Die Konstanten bzw. Parameter
sind für eine bequemere Eingabe über eine normale PCTastatur (mit
6-pol. Mini-DIN-Tastaturstecker PS/2) eingebbar. Die Tastatur wird durch
die Schieblehrenanzeige mit Spannung versorgt. Besonders praktisch und
platzsparend sind hier so genannte Nummern- Pads, kleine
Zusatztastaturen, die dem Nummernblock einer normalen Tastatur
entsprechen. Aber auch die gut gegen Eindringen von Staub und z. B.
Spänen gekapselten Folientastaturen, die es sogar in aufrollbarer
Version gibt, sind für den relativ rauen Werkstattbetrieb gut geeignet.
Wichtig für viele Berechnungen ist auch die Möglichkeit, das
Schieblehrensignal mit umgekehrtem Vorzeichen anzeigen und entsprechend
berechnen zu können. Auch eine Rückstellung der Anzeige an der
Schieblehre auf null ist von der SLA 1 aus ebenso möglich wie die
Spannungsversorgung der Schieblehre. Und schließlich sind die
ermittelten bzw. berechneten Daten über eine serielle Schnittstelle zur
weiteren Verarbeitung oder Archivierung an einen PC ausgebbar. Wollen
wir die Details zu den Möglichkeiten dieses interessanten Gerätes einmal
anhand der Beschreibung der Bedienung näher betrachten.Bedienung
Um
eine komfortable Bedienung zu ermöglichen, besitzt die SLA 1 ein
4-zeiliges LC-Display. Damit ist sehr übersichtlich eine menügeführte
Bedienung realisierbar. Als Bedienelemente dienen die Funktionstasten 1
bis 4, die Menü/OK- sowie die Zurück-Taste. Zum Verändern von Konstanten
kommt der Drehgeber zum Einsatz. Optional können einige Einstellungen
über die bereits erwähnte PC-Tastatur verändert werden. Mit den Tasten 1
bis 4 ist jeweils der Menüpunkt 1 bis 4 oder eine spezifische Funktion,
die im Display am Ende der Zeilen angezeigt wird, auswählbar. Mit der
Menü/OK-Taste gelangt man direkt ins Menü bzw. bestätigt veränderte
Werte. Mit „Zurück“ schließlich schaltet man wieder eine Menüebene höher
(ohne Speichern einer Änderung). Nach dem Anschluss der
Versorgungsspannung an SLA 1 (Steckernetzgerät, 9 VDC) erscheint
zunächst eine Information über das Gerät und die VersionsnumUm eine
komfortable Bedienung zu ermöglichen, besitzt die SLA 1 ein 4-zeiliges
LC-Display. Damit ist sehr übersichtlich eine menügeführte Bedienung
realisierbar. Als Bedienelemente dienen die Funktionstasten 1 bis 4, die
Menü/OK- sowie die Zurück-Taste. Zum Verändern von Konstanten kommt der
Drehgeber zum Einsatz. Optional können einige Einstellungen über die
bereits erwähnte PC-Tastatur verändert werden. Mit den Tasten 1 bis 4
ist jeweils der Menüpunkt 1 bis 4 oder eine spezifische Funktion, die im
Display am Ende der Zeilen angezeigt wird, auswählbar. Mit der
Menü/OK-Taste gelangt man direkt ins Menü bzw. bestätigt veränderte
Werte. Mit „Zurück“ schließlich schaltet man wieder eine Menüebene höher
(ohne Speichern einer Änderung). Nach dem Anschluss der
Versorgungsspannung an SLA 1 (Steckernetzgerät, 9 VDC) erscheint
zunächst eine Information über das Gerät und die Versionsnummer. Danach
wird direkt in das Hauptmenü gesprungen. Von hier aus kann man die
Einstellungen vornehmen. Auf der PC-Tastatur entsprechen die Tasten 1
bis 4 den Funktionstasten 1 bis 4. Die Enter-Taste entspricht der Taste
„Menü/OK“. Falls die Belegung in einem Menü anders ist, so wird darauf
jeweils gesondert hingewiesen. Alle Änderungen werden im integrierten
EEPROM gespeichert und bleiben damit auch nach einem Neustart erhalten.Grundanzeige
Durch
einen Druck auf die Taste „Zurück“ gelangt man in die Grundanzeige. Das
erste Zeichen in jeder Zeile zeigt an, ob eine Schieblehre
angeschlossen und wie deren Status ist.
|
| Bild 1: Beispiel für die Darstellung der Messwerte |
Anzeige
Für
jede Zeile in der Grundanzeige kann man einstellen, welcher Wert
angezeigt werden soll. Dabei ist es gleichgültig, ob sich der Wert aus
einem Messwert, einer Konstante oder aus Kombinationen aus beiden
ergibt.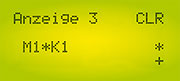
|
| Bild 2: Einstellen der Anzeigewerte |
Konstanten
Es
können vier unabhängige Konstanten im Bereich von -999.99 bis 999.99
verarbeitet werden. Hierbei ist auch die PCTastatur zum Eingeben der
Werte nutzbar. Die Funktionstaste „1“ an der SLA 1 besitzt hier die
Funktion „0“. Sie kann zum Zurücksetzen der Konstante auf null genutzt
werden. In der Menüzeile ist die erste Stelle vor dem Komma
unterstrichen. Mit den Funktionstasten „3“ und „4“ kann man diesen
Unterstrich auf die gewünschte Stelle verschieben. Mit dem Drehgeber
wird hier nun die Ziffer eingegeben. Dabei erfolgt in der Anzeige nach
der 9 ein automatischer Überlauf zur nächsten Stelle, es genügt also
durchaus die Anwahl der ersten Stelle und dann die Eingabe durch
fortlaufendes Drehen des Drehgebers. Wird die Tastatur zu Hilfe
genommen, kann jederzeit eine komplette Zahl eingegeben werden, diese
wird unmittelbar in die Anzeige übernommen. Mit den Tasten „Enter“ auf
der Tastatur oder „Menü/OK“ auf dem Gerät wird der eingegebene Wert
bestätigt.Vereinfachte Konstanten-Eingabe
Konstanten
lassen sich auch eingeben bzw. ändern, ohne dass man hierfür über
mehrere der beschriebenen Schritte das Konstanten-Menü anwählen muss.
Befindet man sich in der Grundanzeige, so genügt ein Druck auf die „*“-
Taste der Tastatur. Es wird das Menü „Konstanten“ angezeigt, wo mit den
Tasten 1 bis 4 auf der Tastatur die gewünschte Konstante ausgewählt
wird. Jetzt ändert man den Wert wie oben beschrieben und geht mit der
Enter- Taste wieder zur Grundanzeige zurück. Will man den Wert nicht
ändern, so ist wiederum die „*“-Taste zu betätigen.RS232-Port
Um
die Daten auf anderen Geräten wie etwa einer externen
LED-7-Segmentanzeige (diese hat den Vorteil der guten Ablesbarkeit auch
auf größere Entfernungen) oder einem PC darzustellen, können die Daten
über die serielle Schnittstelle der SLA 1 ausgegeben werden. Die
Baudrate der Datenübertragung ist flexibel. Es stehen im RS232-Menü die
Geschwindigkeiten 9600, 19.200 oder 57.600 Bit/s zur Verfügung.
Natürlich ist der Versand der Daten über dieses Menü auch sperrbar
(Option „Aus“).Schieblehren – die Technik
Die
meisten digitalen Schieblehren werden mit einer 1,5-V-Knopfzelle
gespeist. Hier ist die positive Batteriespannung mit dem Gehäuse der
Schieblehre verbunden und damit Schaltungsmasse. Viele Schieblehren
werden mit einem Datenausgang mit vier Anschlüssen ausgeliefert, diese
sind für den Anschluss der SLA 1 einsetzbar.
|
| Bild 3: Typische Anschlussbelegung einer Schieblehre |
Signalpegel
An
den Anschlüssen der Schieblehren wird neben der Batteriespannung auch
eine Clock- und eine Data-Leitung herausgeführt. Die Datenleitungen
führen dabei negatives Potential, bezogen auf Masse. Der Prozessor der
Schieblehre gibt über diese Leitungen den aktuellen Messwert in festen
Intervallen aus. Es werden zwei Messwerte übertragen, zum einen ein
absoluter Messwert und zum anderen der aktuell angezeigte Messwert.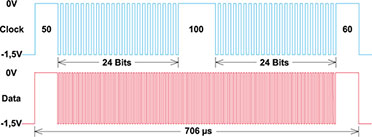
|
| Bild 4: Datenpaket einer Schieblehre |
Datenaufbau
Die
Daten werden in zwei Datenwörtern mit je 24 Bit ausgegeben. Das
Datenformat ist binär. Dabei wird immer das LSB (least significant bit)
zuerst ausgegeben. Da auch negative Zahlen angezeigt werden können,
erfolgt die Darstellung der Daten im so genannten Zweier-Komplement. Der
beste Zeitpunkt zum Auswerten der Datenbits ist das Auftreten der
negativen Flanke des Clock-Signals. Die Daten sind für eine Anzeige noch
umzurechnen.Reset und Modeumschaltung

|
| Bild 5: Beschaltungsbeispiel für die Reset und Modeumschaltung |
Schaltung
Die
Schaltung (Abbildung 6) ist in mehrere Funktionsgruppen aufteilbar:
Spannungsversorgung, Signalaufbereitung, Steuerung/Anzeige/Bedienung
sowie TTLRS232- Wandlung.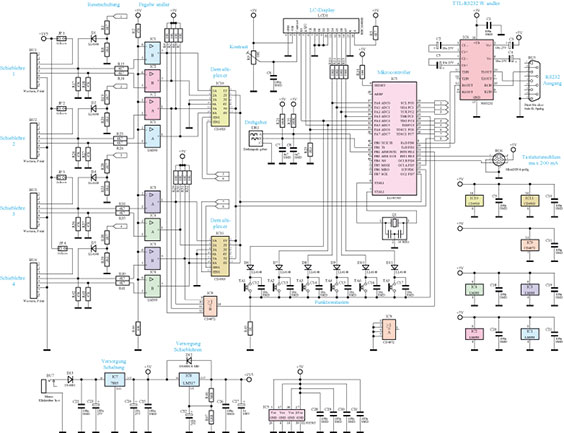
|
| Bild 6: Schaltung der Schieblehrenanzeige |
Die
Spannungsversorgung der Schaltung kann über ein externes
9-VDC-Steckernetzteil erfolgen. Die Diode D 13 dient als Ver-polschutz.
Der Spannungsregler IC 7 erzeugt aus der Eingangsspannung die
5-V-Betriebsspannung für die Schaltung. Aus dieser Spannung wird noch
einmal die 1,5-V-Versorgungsspannung für die Schieblehren erzeugt. IC 8
ist ein einstellbarer Spannungsregler, dessen Ausgangsspannung mit den
Widerständen R 46 und R 47 festgelegt wird. Die Kondensatoren C 23, C
24, C 27 sowie C 32 dienen der Pufferung der Spannung. C 22, C 25 und C
26 sind zur Schwingungsunterdrückung und zur Filterung von Oberwellen
eingesetzt. Die Signale der Schieblehren werden über die Western-Buchsen
BU 1 bis BU 4 eingespeist. Da es sich um vier gleichwertige Eingänge
handelt, beschreiben wir hier nur Eingang 1. Das negative Potential der
Schieblehre wird an Pin 6 von BU 1 angeschlossen und von dort mit der
Schaltungsmasse verbunden. Die positive Spannung von der Schieblehre
wird für die Datenaufbereitung nicht benötigt. Wenn jedoch in der
Schieblehre keine eigene Batterie eingesetzt werden soll, kann sie von
der Anzeigeschaltung mit Spannung versorgt werden, indem JP 1 mit einem
gesteckten Jumper die Verbindung zur 1,5-V-Spannung herstellt. Da die
externe Versorgung zu einer verringerten Störfestigkeit der Schieblehre
führt, sollte die korrekte Funktion der Schieblehre vorher ausreichend
getestet werden. Die beiden Eingangssignale „Data“ und „Clock“ gelangen
über die Widerstände R 15 und R 16 auf die nicht-invertierenden Eingänge
zweier Operationsverstärker (IC 1 B/IC 2 B). Deren invertierender
Eingang wird über einen Spannungsteiler, bestehend aus R 2 und R 44, auf
0,87 V angehoben. Die Signale am Clock- und Data-Eingang werden durch
die Operationsverstärker auf 5 V verstärkt. Die Widerstände R 17 und R
18 sorgen dafür, dass bei nicht angeschlossener Schieblehre der Eingang
der Operationsverstärker auf Masse gezogen wird. Die Schaltung aus R 1, R
8 und D 1 wird für das Zurücksetzen der Anzeige an der Schieblehre auf
„0.00“ benötigt. Soll ein Reset erfolgen, wird Pin 19 des
Mikrocontrollers auf +5 V angehoben. R 1 und R 8 teilen diese Spannung
an D 1 auf etwa 2,2 V. An der Diode selbst entsteht ein Spannungsabfall
von etwa 0,7 V. Dadurch erfolgt ein Anheben der Spannung an der
Clock-Leitung auf etwa 1,5 V. Wie bereits beschrieben, wird dadurch ein
Reset der Schieblehre (Setzen der Anzeige auf „0.00“) erreicht. Da die
Ausgänge der Operationsverstärker Open-Collector-Ausgänge sind, benötigt
man die Widerstände R 4 und R 5 als Pull-up-Widerstände. Die
Ausgangspegel der Operationsverstärker gelangen auf die Eingänge von IC
10. Dieses IC ist ein Puffer mit Tri-State-Ausgang. Es kommt hier als
Demultiplexer zum Einsatz. 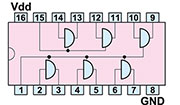
|
| Bild 7: Der interne Aufbau des CD4503 |
Nachbau
Der
SLA 1 ist in Mischbestückung mit bedrahteten und oberflächenmontierten
(SMD-) Bauteilen ausgeführt. Zur Vereinfachung des Aufbaus sind die
SMD-Bauteile schon vorbestückt. Es ist also nur noch ein Bestücken der
bedrahteten Bauteile notwendig. Hierbei wird so vorgegangen, dass zuerst
die flachen Bauteile und dann die größeren Bauteile eingelötet werden.
Dies beginnt mit der Diode D 13 und den ICs IC 10 und IC 11. Dabei ist
auf die richtige Einbaulage zu achten. Das IC muss genau so eingelötet
werden, wie es der Aufdruck auf der Platine vorgibt. Danach erfolgt das
Vorbereiten der Spannungsregler IC 7 und IC 8. Dazu sind die
Anschlusspins in ca. 2,5 mm Abstand vom IC-Gehäuse um 90° nach hinten
abzuwinkeln. Nach dem Einsetzen der ICs in die Platine erfolgt deren
mechanische Befestigung mit M3x8-mm-Zylinderkopfschrauben, Zahnscheiben
und Muttern. Diese sind sorgfältig zu verschrauben, da die Platine als
Kühlfläche für die Spannungsregler dient. Anschließend erfolgt das
Verlöten der Anschlüsse. Als Nächstes wird das Potentiometer R 9 zum
Einstellen des Displaykontrastes eingesetzt und verlötet. Es folgen die
Mono- Klinkenbuchse BU 7, die Jumper-Stiftleisten J 1 bis J 4 und die
6-polige Mini- DIN-Buchse zum Anschluss einer PS/2- Tastatur. Bei deren
Einlöten ist sehr genau zu arbeiten, da der Abstand zwischen den
Kontakten sehr gering ist. Jetzt sind die Elektrolyt-Kondensatoren C 2
bis C 5, C 23, C 24, C 27 und C 32 polrichtig einzusetzen und ihre
Anschlüsse an der Platinenunterseite zu verlöten. Als Nächstes werden
die Print-Buchse BU 5 sowie die vier Western-Buchsen BU 1 bis BU 4
eingesetzt und ihre Anschlüsse sorgfältig verlötet. Bevor nun das
Display montiert wird, ist es mit der einreihigen Stiftleiste zu
bestücken. Diese setzt man dann in die zugehörigen Bohrungen ein,
verlötet sie aber noch nicht. Denn zuerst ist das Display mit den 4,5 mm
langen Distanzröllchen und 4 Schrauben M2,5 x 12 mm sowie
Fächerscheiben auf der Bestückungsseite zu befestigen. Erst dann
verlötet man die Kontakte der Stiftleiste mit der Platine. Damit ist die
Platine fertig bestückt und kann nach einer abschließenden Kontrolle
auf vergessene Lötstellen, Lötzinnbrücken oder Bestückungsfehler in das
mitgelieferte Gehäuse eingesetzt werden. Dazu legt man die Platine in
die untere Halbschale des Gehäuses ein und befestigt sie mit den 6
Schrauben 2,2 x 5 mm. Danach wird die obere Halbschale aufgesetzt. Mit
den vier Schrauben 2,2 x 16 mm sind schließlich die beiden Halbschalen
miteinander zu verbinden. Damit ist der Aufbau beendet und das Gerät
kann eingesetzt werden.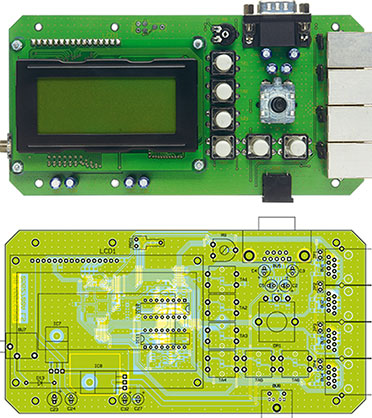
|
| Ansicht der fertig bestückten Platine der Schieblehrenanzeige mit zugehörigem Bestückungsplan von der Bestückungsseite |
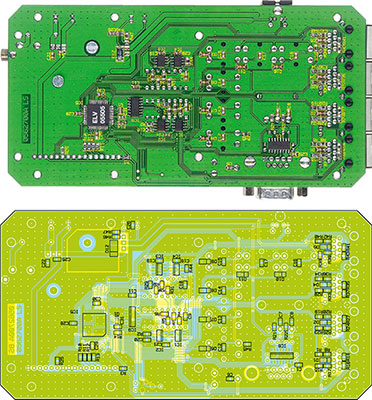
|
| Ansicht der fertig bestückten Platine der Schieblehrenanzeige mit zugehörigem Bestückungsplan von der Lötseite |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (7 Seiten)
als PDF (7 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Schieblehrenanzeige SLA 1
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo






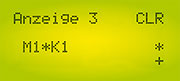

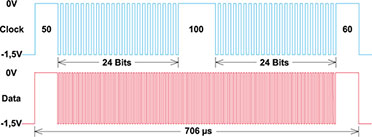

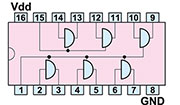
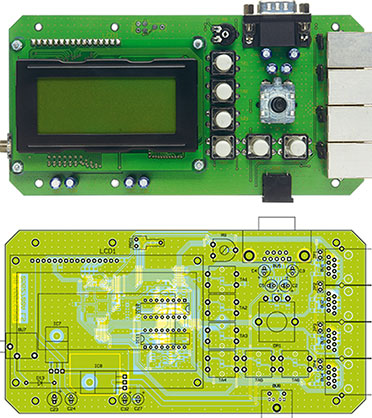
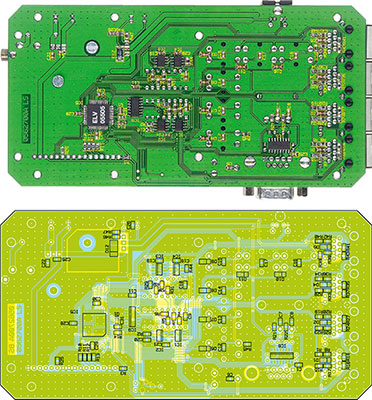
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (7 Seiten)
als PDF (7 Seiten)