Verstärkertechnik in der Audiowelt Teil 1/5: Einleitung und Historie
Aus ELVjournal
06/2005
0 Kommentare
Musik, Musik …
Die
elektronische Übertragung von Sprache und Musik ist aus unserem
heutigen, modernen Leben nicht mehr wegzudenken. So informiert uns das
Radio morgens über das Neueste aus der Welt, die freundliche Stimme am
Bahnsteig nennt uns die Richtung der einfahrenden Züge, und am
Wochenende genießen wir Musik im Wohnzimmer oder auf einer
Veranstaltung. Alles ganz selbstverständlich. Mal kommt die Musik von
der CD oder aus dem Radio, mal wird über ein Mikrofon gesprochen oder
mit einer Musikgruppe elektrisch verstärkt gespielt. Jedesmal sind
elektronische Verstärker im Spiel, die die elektrischen Signale aus den
Signalquellen in kräftige Ströme verwandeln, um sie über Lautsprecher
hörbar zu machen. Viele verschiedene Anwendungen für einen einzigen
Zweck, nämlich den Betrieb eines Lautsprechers zur Wiedergabe von
Sprache und Musik. Wir möchten Ihnen in einer Artikelserie die
verschiedenen Verstärkertechniken in der Audiowelt, sei es für ein
Musikinstrument, für die Beschallung des Bahnsteigs, für die heimische
Stereo- bzw. Surroundanlage oder aber für das Rockkonzert am Wochenende
von den Anfängen bis heute näher bringen. Wir wollen die Anfänge der
Röhrentechnik, die bahnbrechenden Entwicklungen der 50er Jahre und
natürlich die Transistortechnik in den verschiedenen Anwendungen unter
die Lupe nehmen. Hierbei kommen sehr viele Fragen, Begriffe und
Technologien zur Sprache, welche viele Verwirrungen und
Fehlinterpretationen verursachen können: Wie viel Watt brauche ich?
Warum muss ein Frequenzgang von 0 Hz bis 1 MHz gehen? Ist ein Verstärker
mit 0,001 % Klirrfaktor immer besser als einer mit 0,1 %? Sind Röhren
oder Transistoren besser? Was bedeutet 110 dB Rauschabstand? Was ist ein
Class-A- oder ein Class-G-Verstärker? Was verbirgt sich hinter den
Begriffen „single-ended“ und gebrückt? Was bedeutet vollsymmetrisch?
Warum verwendet man geschaltete oder digitale Verstärker? Und, und …
Fragen über Fragen! Diese Artikelserie soll einen Einblick in den – gar
nicht so geheimnisvollen – Dschungel der Audioverstärkertechnik in den
verschiedensten Anwendungen geben. Sie befasst sich mit den
verschiedenen Schaltungstechniken, die im Laufe der Zeit für die
verschiedensten Anforderungen in der Beschallung entwickelt wurden. Es
ist eine Artikelserie für die Neugierigen, die es schon lange einmal
genauer wissen wollten, als auch für Profis zur Ergänzung ihres Wissens.
Eine Serie für Hörer, Entwickler, Beschaller und Musiker. Und
selbstverständlich auch für Selbstbauer! Es sollen keine
wissenschaftlichen Aufsätze mit Theorie und Mathematik bis ins letzte
Detail sein, sondern Beiträge mit umfangreichen Informationen und vielen
praktischen Themen zum beliebigen Weiterverarbeiten. Bitte beachten
Sie: Diese Serie enthält schaltungstechnische Details, die zum Teil
patentrechtlich geschützt sind und somit nicht ohne weiteres gewerblich
genutzt werden dürfen!So fing alles an …
Nach
der Entwicklung der Elektronenröhre durch Robert v. Lieben in
Österreich und Lee Forrest in Amerika, basierend auf dem Edisoneffekt,
Ende des 19. Jahrhunderts, begannen namhafte Firmen wie z. B. Dietz und
Ritter, Philips oder Telefunken in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts
mit der Entwicklung von Audioverstärkern für die Wiedergabe von
Schallplatten und Radioprogrammen sowie für die Beschallung von Kinos,
Sälen und Großveranstaltungen. Zu dieser Zeit gab es nur Trioden, also
Röhren mit 3 Elektroden. Über die Glühkatode wurden damals mittels eines
glühenden Wolfram-Drahtverhaus die Elektronen ausgesendet und bei den
kommerziellen Röhren mit einem rohrförmigen Blech – der Anode – wieder
eingefangen.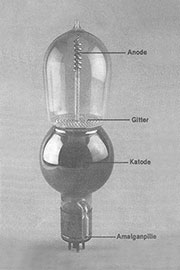
|
| Bild 1: Die Liebenröhre (Quelle: Elektor) |
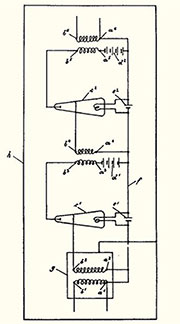
|
| Bild 2: Schaltbild aus einer Patentschrift eines Eintaktverstärkers von 1918 (Quelle: Elektor) |
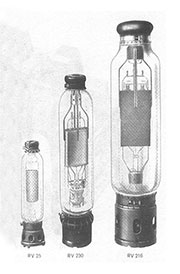
|
| Bild 3: Einige Röhren der Großverstärkertechnik von 1930 (Quelle: Elektor) |
Moderne Technik?
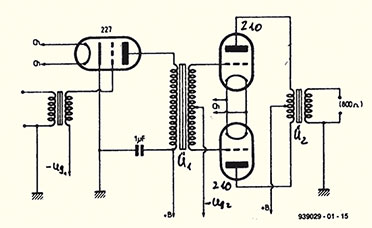
|
| Bild 4: Schaltbild einer Gegentaktendstufe von 1930 (Quelle: Elektor) |
1947: Die Revolution der modernen Elektronik!
Der
Transistor Im Dezember 1947 gelang es den Herren John Bardeen, Walter
Brattain und William Shockley, in den Bell-Labs den ersten Transistor
herzustellen. Diese bahnbrechende Erfindung wurde 1951 patentiert und
1956 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Mit dem Aufkommen der ersten
Transistorradios 1954 wurde die kleine Firma Texas Instruments als
damals weltweit einziger Großserienhersteller für Transistoren
weltbekannt. Ein paar Meilensteine aus den Anfängen der
Halbleitertechnik:
1948 – Punkt-Kontakt-Transistor
1950 – Einkristall-Germanium
1952 – Einkristall-Silizium
1955 – Diffused Basetransistor
1960 – Planar Transistor
1960 – MOS Transistor
1960 – Epitaxial Transistor
1961 – Integrierte Schaltung
In
den 60ern kamen dann die ersten Transistorverstärker auf, welche
anfangs noch ähnlich wie Röhrenverstärker mit Zwischen- und
Ausgangsübertrager gebaut waren (Abbildung 5). 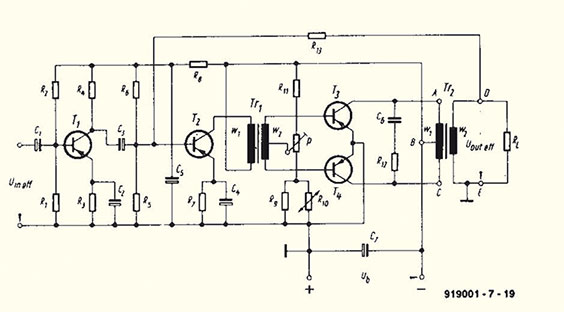
|
| Bild 5: Schaltbild einer der ersten kommerziellen Transistorendstufen von Telefunken 1964 (Quelle: Elektor) |
Diese
Endstufenschaltungen waren noch bis in die 80er Jahre hinein in
tragbaren Transistorradios zu finden. Die Techniken der
Transistorverstärker wurden in den 70er und 80er Jahren mit der
Weiterentwicklung der Transistoren zur Perfektion getrieben. Anfang der
70er gab es nur NPNLeistungstransistoren bis 60 V und 15 A Maximalstrom
(z. B. 2N3055), mit denen sich Verstärker bis ca. 200 W Ausgangsleistung
an 4 Ω aufbauen ließen. Die Audioperformance war auch durch die
sonstigen technischen Daten der Transistoren begrenzt. Es gab keine
Komplementärpaare größerer Leistung mit relativ linearer
Stromverstärkung und hoher Transitfrequenz. Diese Transistoren wurden
erst Ende der 70er Jahre entwickelt und auf den Markt gebracht. Dennoch
gelang es einigen Entwicklern, aus diesen langsamen und wenig linearen
Bauteilen beachtliche Tonqualitäten herauszukitzeln. Hier tauchen wieder
die Namen QUAD und McIntosh auf. Mit den neuen Leistungstransistoren
mit Kollektor-Emitter-Spannungen bis über 300 V und Transitfrequenzen
bis 60 MHz sowie mit neuen und teils aufwändigen Schaltungstechniken mit
symmetrischen Differenzverstärkern am Eingang konnten
Ausgangsleistungen bis über 1000 W bei Klirrfaktoren bis unter 0,001 %
erreicht werden. Es war jetzt auch möglich, Lautsprecher mit Impedanzen
unter 1 Ω ohne spezielle Übertrager zu betreiben. Frequenzgänge vom
Gleichstrom bis in den Mittelwellenbereich waren aufgrund der
verfügbaren, sehr schnellen Leistungstransistoren, kombiniert mit
schnellen Vorverstärkerschaltungen, kein Problem mehr. 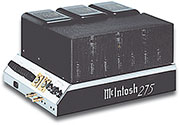
|
| Bild 6: Die legendäre McIntosh MC 275 kann sich auch heute noch in der Referenzklasse behaupten |
Quellen:
- Rainer zur Linde: Verstärker in Röhrentechnik, Elektor
- Rainer zur Linde: Schaltungen historischer Audio-Röhrengeräte, Elektor
- www.mcintoshaudio.com
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (3 Seiten)
als PDF (3 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Verstärkertechnik in der Audiowelt Teil 1/5: Einleitung und Historie
| weitere Fachbeiträge | Foren | |
Hinterlassen Sie einen Kommentar:







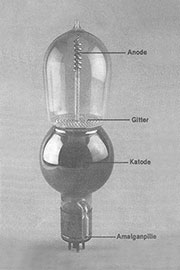
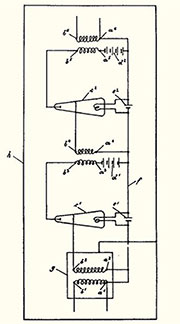
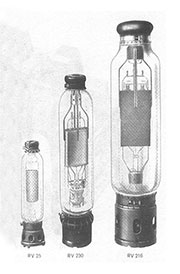
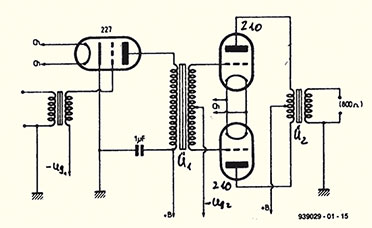
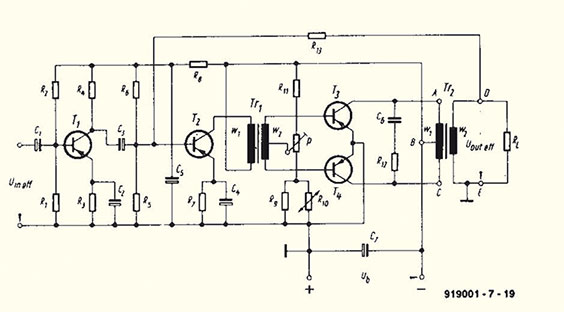
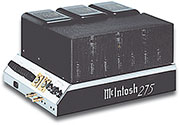
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (3 Seiten)
als PDF (3 Seiten)



