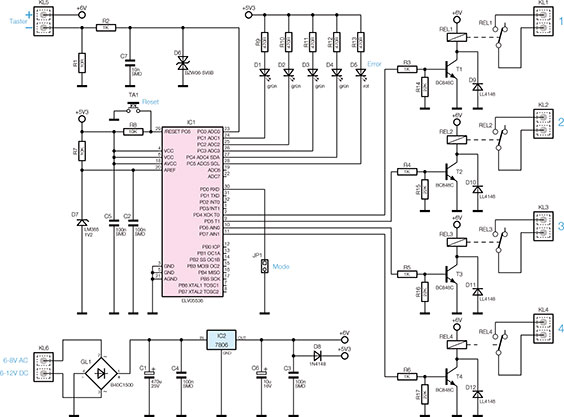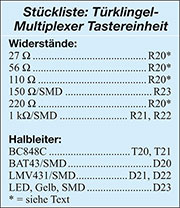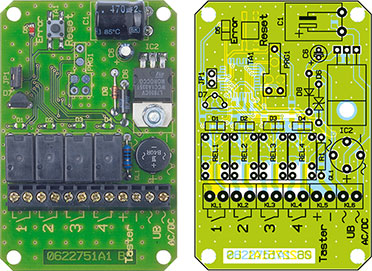Türklingel-Multiplexer TKM 1
Aus ELVjournal
02/2006
0 Kommentare
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 6–8 VAC oder 6–12 VDC |
| Stromaufnahme (Leerlauf) | 8 m A |
| Mit vier Tastereinheiten | 65 mA |
| Schaltausgänge | potentialfrei max. 40 V/1 A |
| Max. Kabellänge | bis 50 m (je nach Leitungsquerschnitt) |
| Abmessungen Basisplatine | 72 x 47 mm |
| Abmessungen Tasterplatine | 24 x 8 mm |
Der
Türklingel-Multiplexer erweitert eine vorhandene Hausklingelanlage in
2-Draht-Technik, die in der Regel nur mit einem Taster ausgestattet ist,
auf bis zu vier „Klingelkanäle“, ohne dass zusätzliche Leitungen
verlegt werden müssen. Jedem Taster steht ein separater Relaisausgang
zur Verfügung, mit dem z. B. ein Gong oder Summer geschaltet werden
kann. Zusätzlich wird jede Tastereinheit mit einer LED beleuchtet, und
es ist eine Sturm-Klingelsperre verfügbar.Aus eins mach vier
Anlässe,
eine vorhandene einfache Klingelanlage zu erweitern, gibt es viele. Der
wohl typischste Fall ist der der Wohngemeinschaft (WG), aber auch in
Familien, die mit mehreren Generationen in einem Haus wohnen, ist solch
ein Wunsch immer wieder da. Spätestens dann, wenn der Besuch des
Nachwuchses öfter klingelt, wird wohl der Wunsch nach einer eigenen
Klingel für diesen laut. Derartige Szenarien gibt es viele, auch etwa im
beruflichen Bereich, wenn z. B. eine Gemeinschaftspraxis in ein zuvor
als Einfamilienhaus genutztes Objekt zieht, Werkstatt/Laden/Büro sich
mit im Haus befinden usw. Statt nun eine Vielzahl neuer Leitungen zu
legen oder zu einer teuren Fertiganlage zu greifen, kann man eine
vorhandene 2-Draht-Anlage auch mehrfach nutzen. Die Lösung heißt
„Multiplex-Betrieb“ – durch eine Art „Codierung“ kann man auf einer
Leitung gezielt mehrere Informationen übertragen, die auch genau nur vom
zugeordneten Empfänger ausgewertet werden. Nach diesem Prinzip arbeitet
unser Türklingel- Multiplexer. Er erweitert eine (vorhandene)
2-Draht-Anlage auf bis zu vier Teilnehmer. Auf der Klingeltaster-Seite
ist dabei lediglich eine kleine Platine nachzurüsten, die in nahezu
jedes Klingeltaster- Gehäuse, zumindest aber in den zugehörigen
UP-Kasten, passt und dazu noch eine angenehm dezente, aber helle
LEDBeleuchtung, z. B. für das Namensschild im Klingeltaster, trägt. Die
Steuerelektronik bietet vier Relais- Schaltausgänge, die Klingeln, Gongs
oder Lichtsignalisationsanlagen aktivieren können. Um auch innen
Verkabelungsaufwand sparen zu können (schließlich wird man nicht immer
mehrere verschiedene Türgongs o. Ä. gleichzeitig im Flur montieren
wollen), bietet sich hier die Anbindung eines FS20-Funksenders, z. B.
des FS20 S4A, an, der wiederum den beliebig im Sendebereich
platzierbaren Signalgeber FS20 SIG aktiviert. Den kann der Junior dann
mit seinem Lieblings-MP3-File laden und wird in seinem Reich diskret
„angeklingelt“. Der erwähnte Funksender bereitet keinerlei
Anpassungsprobleme, da er über eine eigene Spannungsversorgung per
Batterie verfügt. Die Steuerung ist in der Nähe des vorhandenen Türgongs
bzw. des Klingeltrafos installierbar und kann auch durch Letzteren mit
Spannung versorgt werden. Sie bietet außerdem, auswählbar über einen
Jumper, die Option einer „Sturmklingelsperre“: Zwischen zwei
Tasterbetätigungen müssen min. 5 Sekunden vergangen sein, wodurch ein
„Dauerklingeln“ verhindert wird.Schaltung
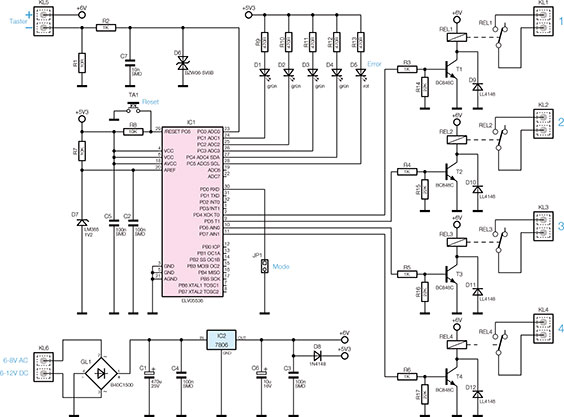
|
| Bild 2: Schaltbild der Basisplatine |
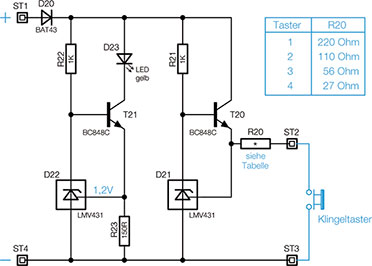
|
| Bild 1: Schaltbild der Tasterplatine |
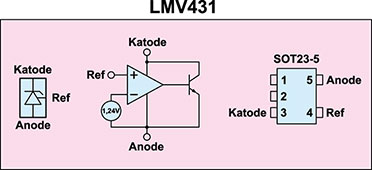
|
| Bild 3: Das Blockschaltbild der LMV431 |
Nachbau
Die
Platinen werden bereits mit SMDBauteilen bestückt geliefert, so dass
nur die bedrahteten Bauteile bestückt werden müssen und der mitunter
mühsame Umgang mit den kleinen SMD-Bauteilen somit entfällt. Hier ist
lediglich eine abschließende Kontrolle der bestückten Platine auf
Bestückungsfehler, eventuelle Lötzinnbrücken, vergessene Lötstellen usw.
notwendig. Wir beginnen zunächst mit der Basisplatine. Die Bestückung
der bedrahteten Bauteile erfolgt in gewohnter Weise anhand der
Stückliste und des Bestückungsplans. Die Bauteilanschlüsse werden
entsprechend dem Rastermaß abgewinkelt und durch die im Bestückungsdruck
vorgegebenen Bohrungen geführt. Nach dem Verlöten der Anschlüsse auf
der Platinenunterseite (Lötseite) werden überstehende Drahtenden mit
einem Seitenschneider sauber abgeschnitten, ohne die Lötstelle selbst
dabei zu beschädigen. Beim Einsetzen der beiden Elkos sowie der Dioden,
mit Ausnahme der Diode D 6, ist auf die richtige Einbaulage bzw. die
richtige Polung zu achten. Die Elkos sind dabei in der Regel am
Minus-Anschluss und die Katode der Dioden durch eine Strichmarkierung
gekennzeichnet. Die Einbaulage von D 7 ergibt sich durch den
Bestückungsaufdruck. Eine gute Hilfestellung gibt hier auch das
Platinenfoto. Der Kondensator C 1 und der Spannungsregler IC 2 werden
liegend montiert, wobei IC 2 mit einer Schraube M3 x 8 mm, Fächerscheibe
und Mutter M 3 auf der Platine befestigt wird. Die Anschlussbeine sind
zuvor im Abstand von 2 mm zum IC-Gehäuse um 90° abzuwinkeln. Als
Nächstes werden die mechanischen Bauteile (Relais und Klemmleisten)
bestückt und verlötet. Für den optionalen Gehäuseeinbau steht ein
unbearbeitetes Gehäuse zur Verfügung, in das noch die Bohrungen für die
Kabelzuleitungen eingebracht werden müssen. Bei der Tasterplatine ist
lediglich der Widerstand R 20 zu bestücken, dessen Wert der Tabelle im
Schaltbild entnommen wird.Installation
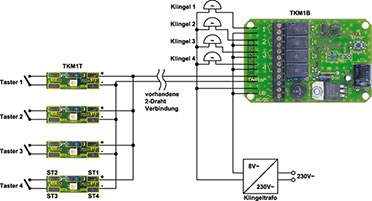
|
| Bild 4: Anschlussplan für eine komplette Installation |
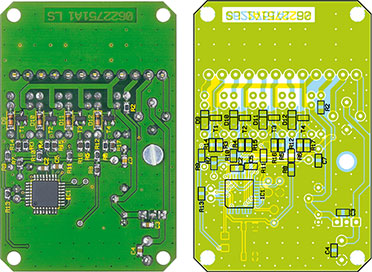
|
| Ansicht
der fertig bestückten Basisplatine des Türklingel-Multiplexers mit
zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von
der Lötseite |
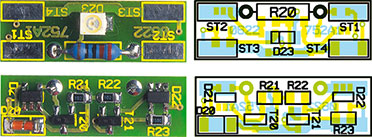
|
| Ansicht
der fertig bestückten Tasterplatine des Türklingel-Multiplexers mit
zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von
der Lötseite |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Türklingel-Multiplexer TKM 1
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo





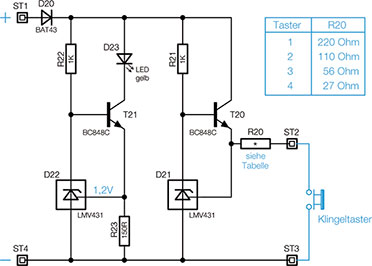
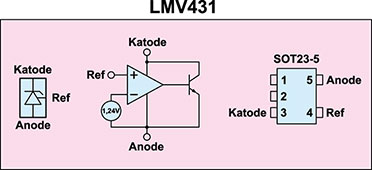
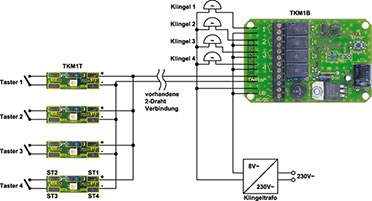
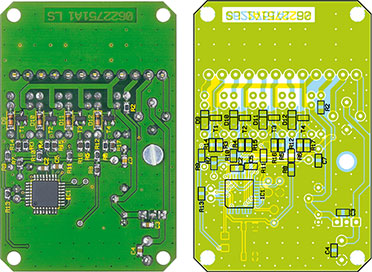
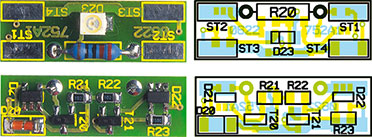
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)