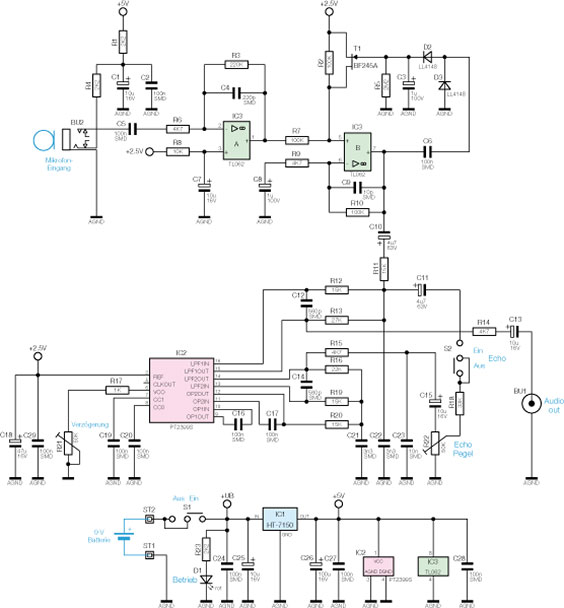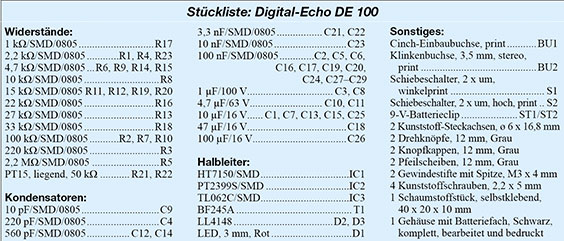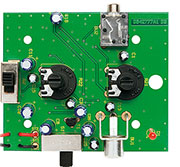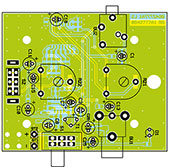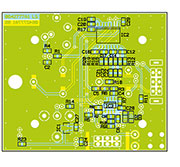Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
- FAQ-Datenbank
- Batterien, Akkus, Ladegeräte
- Bausätze, Lernpakete, Literatur
- Beleuchtung
- Computer-/Netzwerktechnik
- Electronic Components
- Hausautomation - Smart Home
- Haustechnik
- Kfz-Elektronik
- Klima-Wetter-Umwelt
- Messtechnik
- Modellsport, Freizeit
- Multimedia-SAT-TV
- Netzgeräte, Wechselrichter
- Sicherheitstechnik
- Telefon-/Kommunikationstechnik
- Werkstatt, Labor
- Ratgeber
- Batterien - Akkus - Ladegeräte
- Bausätze
- Beleuchtung
- Computer-/Netzwerktechnik
- Electronic-Components
- Freizeit- und Outdoortechnik
- Hausautomations-Systeme
- Haustechnik
- Kfz-Technik
- Klima - Wetter - Umwelt
- Messtechnik
- Multimedia - Sat - TV
- Netzgeräte - Wechselrichter
- Sicherheitstechnik
- Telefon-/Kommunikationstechnik
- Werkzeug - Löttechnik
- Elektronikwissen
- So funktioniert´s
- Praxiswissen
- FAQ-Datenbank
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
- ELVintern
- Experten testen
- Praxiswissen
- So funktioniert´s
- Hausautomation - Smart Home
- Haustechnik
- Beleuchtung
- Sicherheitstechnik
- Klima - Wetter - Umwelt
- Computer/Netzwerk
- Multimedia - Sat - TV
- Telefon - Kommunikation
- Kfz-Technik
- Stromversorgung
- HomeMatic-Know-how
- Freizeit- und Outdoortechnik
- Werkzeug - Löttechnik
- Messtechnik
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo
Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR
Echo-Schaltung DE 100
Aus ELVjournal 04/2006
2 Kommentare

Bausatzinformationen
 |  |  |  |
| 1 | 0,5 | OK | 4/2006 |
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 9-V-Blockbatterie |
| Stromaufnahme | 25 mA |
| Anschlüsse: | |
| Eingang | Mikrofon 3,5-mm- Klinke |
| Ausgang | Line/Cinch |
| Verzögerungszeit | 40 ms bis 400 ms |
| Sonstiges | Automatische Lautstärkeregelung (ALC) |
| Abmessungen (Gehäuse) | 115 x 64 x 28 mm |
Wohl kein Toneffekt ist in der Audiotechnik so beliebt wie der Echo-Effekt. Durch Einsatz eines digitalen Audio-Prozessors können heute Echo-Effekte in sehr hoher Qualität und mit relativ geringem Aufwand erzeugt werden. Unsere batteriebetriebene Echo-Schaltung arbeitet mit einem solchen Audio-Prozessor und besitzt dazu einen Mikrofoneingang mit einer automatischen Verstärkungsregelung (ALC), die eine optimale Aussteuerung erlaubt bzw. ein Übersteuern verhindert.
Echo für alle Fälle
Kein Fahrgeschäft auf der Kirmeswiese ohne Echo-Effekt in der Soundanlage, keine Diskothek, kein Studio kommt ohne aus, und die beliebten Karaoke-Partys schon gar nicht. Und selbst so manches Spielzeug verfügt über eine Echo-Schaltung … Während noch vor wenigen Jahren einiger Aufwand getrieben werden musste, um diesen Effekt in guter Qualität elektronisch zu erzeugen (ältere Leser werden sich noch an die legendäre Echo-Technik mittels spezieller Mehrkopf-Tonbandmaschinen erinnern), erledigen dies heute schon sehr preiswerte, kleine Audio-Prozessoren, die Preis und Herstellungsaufwand deutlich sen ken und ein solches Effektgerät auch im Selbstbau für jedermann zugänglich machen. Der in unserer Echo-Schaltung eingesetzte Audio-Prozessor PT 2399 sticht durch die sehr guten technischen Daten, vor allem den sehr guten Signal-Rausch-Abstand von 90 dB, hervor, und mit ihm kann preisgünstig mit relativ geringem Schaltungsaufwand eine qualitativ hochwertige Echo-Schaltung realisiert werden.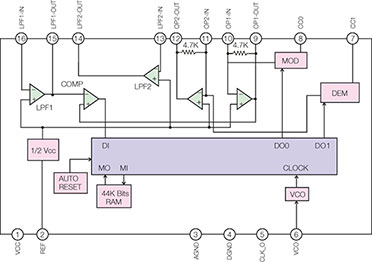 |
| Bild 2: Das Blockschaltbild des PT 2399 |
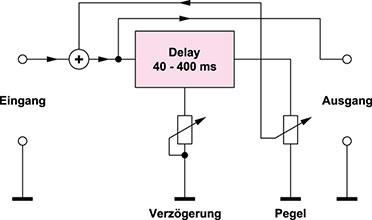 |
| Bild 3: So entsteht das Echo |
Ein
Echo entsteht dann, wenn das verzögerte Signal wieder mit dem
Eingangssignal gemischt wird (siehe Abbildung 3). Die „Stärke“ des Echos
lässt sich mit dem Poti „Echo-Pegel“ (R 22) einstellen. Die
Rückkopplung zum Eingang kann mit dem Schalter S 2 (Echo Ein/Aus)
komplett unterbrochen werden, ohne dabei die Stellung von R 22 verändern
zu müssen. Die weitere Außenbeschaltung (Widerstände und Kondensatoren)
von IC 2 sind externe Komponenten der integrierten Operationsverstärker
von IC 2, mit denen z. B. auch die Grenzfrequenz des Tiefpassfilters
(LPF-OUT) festgelegt wird. Dieses Tiefpassfilter am Ausgang des
A/D-Wandlers ist notwendig, um Anteile der Taktfrequenz des VCO zu
unterdrücken. Über R 14 und C 13 gelangt das NFSignal schließlich zur
Ausgangsbuchse BU 1. Für die Spannungsversorgung der Schaltung kommt
eine 9-V-Batterie zum Einsatz, die über ST 2 (+) und ST 1 (–)
angeschlossen wird. Der Spannungsregler IC 1 erzeugt eine für IC 2
notwendige stabile Spannung von 5 V.
Nachbau
Die Platine wird bereits mit SMD-Bauteilen bestückt geliefert, so dass nur die bedrahteten Bauteile bestückt werden müssen, so entfällt der mitunter mühsame Umgang mit den kleinen SMD-Bauteilen. Hier ist lediglich eine abschließende Kontrolle der bestückten Platine auf Bestückungsfehler, eventuelle Lötzinnbrücken, vergessene Lötstellen usw. notwendig. Die Bestückung der bedrahteten Bauteile erfolgt in gewohnter Weise anhand der Stückliste und des Bestückungsplans. Die Bauteilanschlüsse werden entsprechend dem jeweiligen Rastermaß abgewinkelt und durch die im Bestückungsdruck vorgegebenen Bohrungen geführt. Nach dem Verlöten der Anschlüsse auf der Platinenunterseite (Lötseite) werden überstehende Drahtenden mit einem Seitenschneider sauber abgeschnitten, ohne die Lötstelle selbst dabei zu beschädigen. Beim Einsetzen der Elkos ist unbedingt auf die richtige Einbaulage bzw. die richtige Polung zu achten, wobei in der Regel der Minus-Anschluss am Elko gekennzeichnet ist. Die Einbauhöhe der Leuchtdiode D 1 (gemessen zwischen LED-Oberkante und Platine) muss genau 18 mm betragen. Die Polung der LED ist durch den etwas längeren Anoden-Anschlussdraht (+/Anode) erkennbar.Als
nächstes werden die Buchsen, Schalter und die beiden Potis bestückt und
verlötet. Die Potis werden mit Steckachsen versehen, auf die dann
später bei geschlossenem Gehäuse die Drehknöpfe aufsteckt werden. Zum
Schluss ist noch das Anschlusskabel für die Batterie anzulöten. Das
Kabel wird, wie im Platinenfoto zu erkennen, durch die Bohrungen in der
Platine gefädelt, wobei die rote Zuleitung mit dem Anschluss „+“ und die
schwarze Leitung mit dem Anschluss „–“ verlötet wird. Nachdem die
Platine so weit aufgebaut ist, erfolgt nach einer sorgfältigen
Endkontrolle auf Bestückungs- und Lötfehler der Einbau in das Gehäuse.
Hierzu wird die Platine zunächst mit vier Kunststoffschrauben 2,2 x 5 mm
im Gehäuseunterteil befestigt. Nachdem man das Gehäuseoberteil mit dem
Gehäuseunterteil verschraubt hat, sind die Drehknöpfe mit Pfeilscheibe
und Kappe zu versehen, lagerichtig (Pfeil muss mit Skala
korrespondieren) auf die Steckachsen aufzustecken und seitlich jeweils
mit der zugehörigen Madenschraube zu fixieren. Damit die Batterie später
spielfrei im Gehäuse liegt, wird in das Batteriefach ein Stück
Schaumstoff geklebt.
Inbetriebnahme und Bedienung
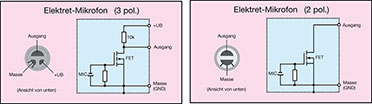 |
| Bild 4: Anschlussbelegung von 2- und 3-poligen Elektret-Mikrofonen |
 |
| Ansicht der fertig bestückten Platine des DE 100 mit zugehörigem Bestückungsplan, die oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version
als Online-Version als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:
- Echo-Schaltung DE 100
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
| Foren |
Kommentare:
01.09.2014 schrieb Ulrich Jäggi:
„Möchte gerne diesen Beitrag lesen Echo-Schaltung DE 100 Danke”
„Möchte gerne diesen Beitrag lesen Echo-Schaltung DE 100 Danke”
Hinterlassen Sie einen Kommentar: