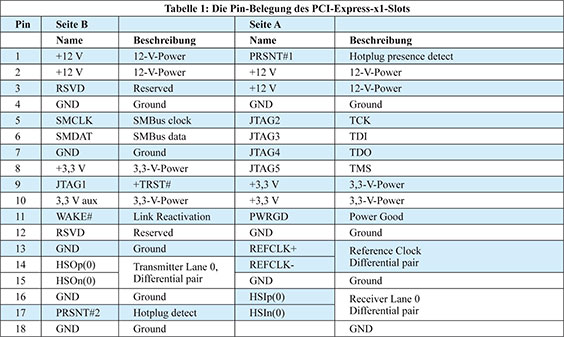Schneller, weiter, kabelloser – Neues aus der PC-Welt
Aus ELVjournal
06/2006
0 Kommentare
PCI-Express – der Erbe von AGP und PCI
Das
PCI-Bussystem, wie wir es seit Beginn der 90er Jahre kennen, war damals
schnell, sogar sehr schnell. Mit 33 MHz Takt und 133 MByte/s Bandbreite
sowie 32 Bit Busbreite genügte es immerhin über 10 Jahre lang den
Anforderungen der PC-Nutzer. Allerdings muss man bedenken, dass diese
Bandbreite nur auf einem parallel arbeitenden Bus zur Verfügung steht
und unter allen Peripheriebausteinen des Rechners aufgeteilt werden
muss. Allein die Sound-Option „frisst“ enorm Bandbreite, dann kommen da
noch Komponenten wie LAN, USB, IDE und vor allem Grafik. Besonders im
Zuge der Entwicklung von Computerspielen, 3D-CAD-Programmen und der
Videoverarbeitung auf dem PC tat sich bald der erste PCI-Engpass auf –
der Datentransport zur Grafikkarte wurde zum Flaschenhals. Deshalb wurde
für die Grafikkarte der AGP-Standard entwickelt, ein vom PCI-Bus
unabhängiger Grafik-Port, der direkt mit dem Chipsatz des Motherboards
kommuniziert (Abbildung 1). Moderne AGP-8x-Karten erreichen darüber
immerhin beeindruckende Bandbreiten von 2,133 GBit/s.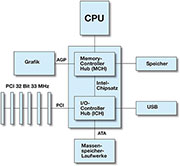
|
| Bild 1: Der Aufbau eines PCI-Systems. |
Seriell statt parallel
Gegenüber
den früheren Parallel-Standards ISA und PCI ging man hier einen neuen
Weg – die Daten werden nicht mehr parallel, sondern seriell über den Bus
geschickt, so, wie es beispielsweise beim inzwischen etablierten
SATA-Standard für den Anschluss von Festplatten geschieht. Damit muss
man nicht mehr Rücksicht auf die exakte Synchronisation der Bits auf
einem 32 Bit breiten Bus nehmen, sondern die Daten werden seriell mit
einem Takt von 2,5 GHz übertragen. Heraus kommt dabei eine Datenrate von
250 MByte/s je Richtung. Der Host des PC-Chipsatzes nimmt also zu jedem
per PCI-Express angeschlossenen Gerät eine direkte
Punkt-zu-Punkt-Verbindung auf, schnelle Switches sorgen für die
hierarchieabhängige Anbindung von Peripheriekomponenten. Die
Daten-übertragung erfolgt nach dem LVDS-Prinzip (störsichere
Signalübertragung über sehr geringe Differenzspannungen) über so
genannte Lanes (Straßen), die jeweils aus einem Leitungspaar für Senden
und Empfangen bestehen (Abbildung 2).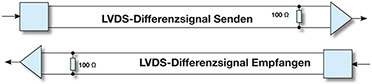
|
| Bild
2: Eine Lane besteht aus zwei Leitungspaaren, jeweils mit den
zugehörigen Treibern für jede Richtung und einem Leitungsabschluss. |
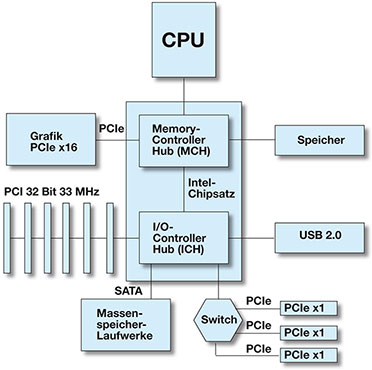
|
| Bild 3: Der Aufbau eines PCI-Express-Systems. |

|
| Bild 4: Ein modernes Motherboard verfügt heute mindestens über PCIe-x1- und -x16-Slots. Bild: MSI-Computer |
PCI-Express für Normalverbraucher
Im
Consumerbereich findet man hauptsächlich PCIe-x1- und -x16-Slots.
Erstere sind für „normale“ PCI-Komponenten wie Netzwerk oder externe
Geräte bestimmt, Letztere aufgrund des enormen Datendurchsatzes von 4
GByte/s für PCIe-Grafikkarten (PEG-Slot), die hier übrigens immerhin mit
bis zu 75 W direkt über den Bus, also ohne direkten Netzteilanschluss
der Karte, versorgt werden können. Sind entsprechende Steckplätze
vorhanden, sind auch mehrere Grafikkarten auf einem Board betreibbar.
Alle Slot-Typen sind abwärtskompatibel, man kann also durchaus eine
x1-Karte in einen x16-Slot stecken. Und im Gegensatz zu PCI-Karten
beeinflussen sich hier langsame und schnelle PCI-Express-Komponenten
nicht.
Wer übrigens seinen Computer mit einem neuen PCI-Express-Board aufrüsten
möchte, aber seine teuer erworbene, schnelle AGP-Grafikkarte vorerst
behalten will, für den gibt es AGP-zu-PCIe-Adapter. Neuentwicklungen
leistungsfähiger Grafikkarten bauen jedoch ausschließlich auf
PCIe-Chipsätzen auf. Die Marktführer ATI und Nvidia stellen hierzu eine
beeindruckende Palette von hochwertigen Grafikkarten zur Verfügung.
Tabelle 1 zeigt die Pin-Belegung des x1-Slots. Hier fällt Pin 17 (B) auf
– Hotplug detect. Ja, PCI-Express ist Hotplug-fähig, eine wichtige
Forderung der PCI-SIG, deren Mitglieder ja alle auch stark im
Serverbereich engagiert sind und hier seit langem die Forderung nach
verbesserter Servicefreundlichkeit im laufenden Betrieb auf dem Tisch
lag. Die Komponenten sind also wie USB auch im laufenden Betrieb
abtrenn- oder ansteckbar, ohne das System zu stören.Voll kompatibel und universell
Ein
weiterer Vorteil des neuen Systems ist die Software-Kompatibilität zu
PCI – auf der Softwareseite muss nichts verändert werden, die Programme
nutzen PCIe genauso wie PCI.
PCI-Express ist so konzipiert, dass es auf verschiedenen
Anwendungsplattformen – also Desktop-Rechnern, Notebooks oder Servern,
PCs oder Macs – anwendbar und so sehr universell einsetzbar ist. Dazu
kommt eine neue PCMCIA-Steckplatz-Architektur. Auch hier steht nun eine
PCI-Express-Schnittstelle für den Anschluss mobiler Komponenten zur
Verfügung.
Fazit: AGP ist tot und PCI auf dem Rückzug. Gegen den neuen
PCI-Express-Standard haben beide keine echte Chance mehr, will man
moderne und vor allem schnelle Hardware nach Industriestandard
einsetzen.Aus SCSI wird SAS
Auch
beim Anschluss von Massenspeichern wie Festplatten kamen die Entwickler
bei immer größeren Busbreiten in Not. Bei einer Datenübertragungsrate
von 320 MBit/s stießen selbst die schnellsten SCSI-Systeme an
physikalische Grenzen der parallelen Busarchitektur, die zudem ohnehin
nur im Halb-Duplex-Betrieb arbeiten kann, also jeweils in der Richtung
umgeschaltet werden muss.
Auch hier erkannte man das LVDS-Prinzip mit seinen geringen Signalpegeln
und Spannungshüben als Lösungsmöglichkeit. Die Datenübertragung erfolgt
wie bei PCI-Express über serielle Lane-Strukturen und geschaltete
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Dass dabei sehr schnelle
Datenübertragungsraten zustande kommen, wissen wir ja schon. Bereits die
inzwischen allgemein genutzte Nachfolge des parallelen ATA-Bus-Systems,
SATA, arbeitet mit diesem Verfahren und realisiert Übertragungsraten
bis 1,5 GBit/s, allerdings immer noch im Halb-Duplex-Verfahren.
SCSI galt hingegen in der PC-Welt schon immer als elitärer Standard, der
mit höchster Performance, der Erweiterung auf bis zu 16 Geräte am Bus
und einem umfangreichen Befehlssatz glänzte. Sein serieller Nachfolger
ist SAS. SAS baut auf der seriellen Technik von SATA auf, verwendet also
die üblichen, einfach zu handhabenden und auch mechanisch einfach
aufgebauten Anschlusskabel, arbeitet wie SATA als
Punkt-zu-Punkt-Verbindung, umgeht aber die umständliche, SCSI-typische
Handhabung wie ID-Vergabe, Terminierung usw. Und SAS beherrscht den
kompletten SCSI-Kommandosatz mit 256 Kommandos, der z. B. Festplatten
veranlasst, Lese- und Schreibvorgänge intelligent zu verwalten und so
das gesamte Transferverhalten schneller zu machen. Für den Anwender
heißt dies auch, dass er SCSI-Systeme softwareseitig nicht umzustellen
braucht – es wird lediglich die Hardware ersetzt.Bis 12 GBit/s angepeilt
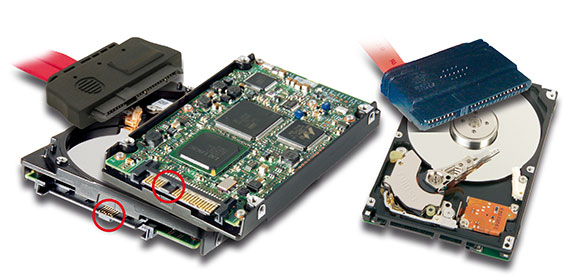
|
| Bild
5: Hier erkennt man gut die SAS-Schnittstelle mit ihrem doppelseitig
belegten Steg, rechts zum Vergleich die SATA-Schnittstelle. Bild:
Fujitsu/Seagate |
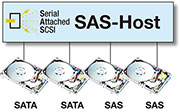
|
| Bild 6: An einem SAS-Host kann man SATA- und SAS-Geräte gemischt betreiben. |
Skalierbar bis auf 16.384 Geräte
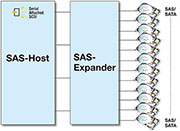
|
| Bild 7: Ein SAS-Host-System ist mit Expandern auf bis zu 16.384 Geräte ausbaubar. |

|
| Bild 8: SAS erlaubt die gemeinsame Nutzung einer Festplatte an zwei Rechnern. |
USB ohne Kabel – WUSB
Dass
selbst die so praktischen USB-Kabel im Alltag lästig werden können,
sobald man mehrere davon hat, hat sicher schon jeder erfahren müssen.
Bluetooth und WLAN schaffen hier für viele Einsatzzwecke per bequemer
Funkverbindung Abhilfe, stoßen jedoch trotz Verschlüsselungsalgorithmen
auf ihren bereits dicht belegten Frequenzbereichen auf Begrenzungen, vor
allem in der Datentransfergeschwindigkeit. Das „USB Implementers Forum“
hat nun einen Standard anwendungsreif gemacht, der es ermöglicht, den
schnellen USB 2.0 „in die Luft“ zu bringen, d. h., bis zu 480 MBit/s
drahtlos über bis zu 3 m zu übertragen – WUSB. Bei einer eingeschränkten
Datenrate von bis zu 110 MBit/s sind sogar bis 10 m überbrückbar.
Die Übertragung erfolgt dabei im Frequenzbereich zwischen 3,1 und 10,6
GHz (Breitband-Kurzstreckenfunk – UWB), der in den meisten Ländern
lizenzfrei ist. 3 m klingt nach nicht besonders viel, löst aber wohl
weitgehend die meisten Aufgaben, die bisher USB-Kabeln vorbehalten waren
– natürlich außer der bequemen Spannungsversorgung via USB. Aber schon
sind erste Chipsätze avisiert, die sogar bis zu 40 m Reichweite bei
einem Datendurchsatz von mehr als 880 MBit/s realisieren sollen.
Der zugehörige Standard zu diesem System heißt IEEE 802.15.3a, die
ersten marktreifen Geräte sind für Ende 2006 avisiert, übrigens nicht zu
verwechseln mit den derzeit vielfach angebotenen
WUSB-Übertragungsgeräten mit dem Zusatz „G“. Die sind nichts anderes als
WLAN und „schaffen“ die üblichen WLAN-Raten von bis zu 54 MBit/s.
Zu den Geräten hin verhalten sich die zunächst meist wie USB-Sticks
aussehenden WUSB-Sender/Empfänger wie normale USB-2.0-Geräte, sie sind
also zum bisherigen drahtgebundenen System voll kompatibel.
Das heißt, auch hier gelten die üblichen USB-Konventionen mit bis zu 127
simultan betreibbaren Geräten an einem Host, der
Punkt-zu-Punkt-Verbindung, einfacher Handhabung,
Plug-&-Play-Funktionalität usw.
Und natürlich merkt man auch auf der Softwareseite nichts von der
Funkstrecke, da der Host im Rechner den WUSB-Stick wie ein normales
USB-Gerät behandelt. Lediglich ein Treiber wie für jedes USB-Gerät wird
benötigt. Der soll im neuen Microsoft-Betriebssystem „VISTA“ bereits
implementiert sein.Neue Geräte mit integriertem WUSB
So
kann man mit WUSB ausgerüstete Festplatten genauso per Funk erreichen
wie Digitalkameras, Drucker, Scanner, MP3- und Videoplayer usw.
Die Industrie plant, mit dem Einstieg in das neue Medium z. B.
Digitalkameras oder Fotodrucker gleich mit einer integrierten
WUSB-Schnittstelle auszurüsten, so dass man hier nichts mehr zusätzlich
anstecken muss.
Mit der erreichbaren hohen Datenrate ist es also auch kein Problem mehr,
etwa Videodaten über einige Meter zu übertragen – das Datenkabel zum
Beamer könnte dann also in Zukunft entfallen. Und auch andere
Anwendungsbereiche sind denkbar.
Der Wermutstropfen zu dieser schönen neuen Technik ist für uns in
Deutschland allerdings auch schon gefunden – wann wir diese Technik
trotz aller Ankündigungen real nutzen können, steht noch in den Sternen.
Derzeit prüft die Bundesnetzagentur die Freigabe der benötigten
Frequenzbereiche, da die bei uns bereits von allerlei Diensten,
einschließlich Polizei und Militär, genutzt werden.
Die beteiligte Industrie wie Intel, Philips, Realtek, Seagate und andere
ist dennoch optimistisch, dass es nach dem Weihnachtsverkauf in den USA
Anfang 2007 auch bei uns losgehen wird – dann ziehen allerdings auch
die vielfach durch das kabelgebundene USB eliminierten Netzteile zu den
USB-Geräten wieder ein …Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (5 Seiten)
als PDF (5 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Schneller, weiter, kabelloser – Neues aus der PC-Welt
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo
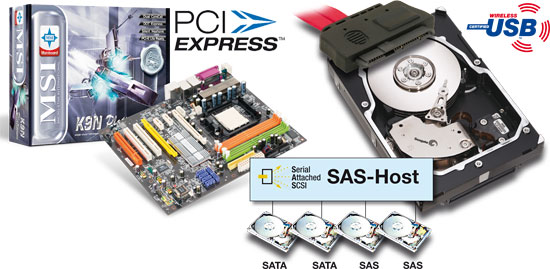
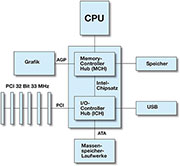
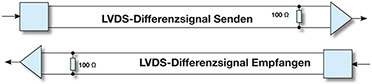
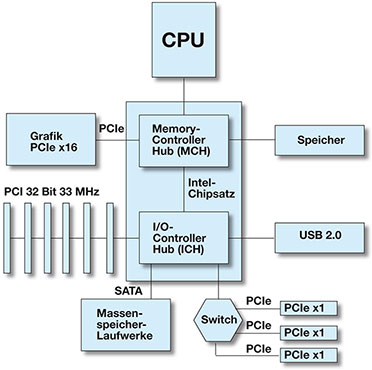

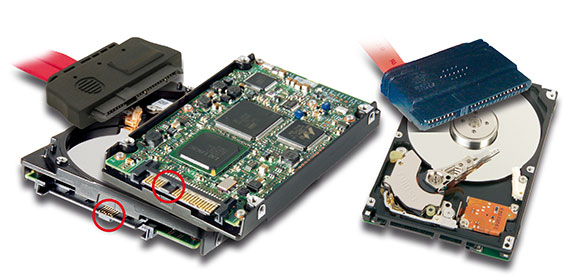
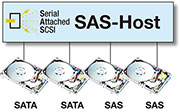
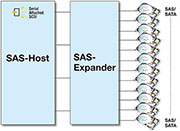

 als Online-Version
als Online-Version als PDF (5 Seiten)
als PDF (5 Seiten)