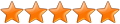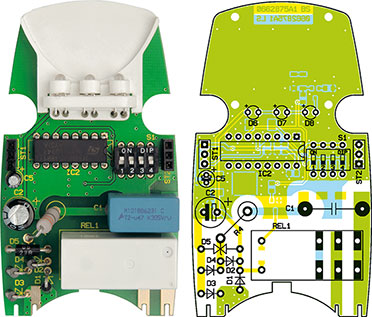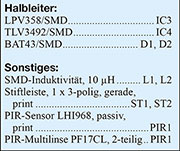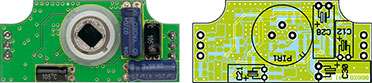LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder PIRS 54
Aus ELVjournal
01/2007
0 Kommentare
Technische Daten
| Funktionsprinzip | Passiv-Infrarot-Detektion |
| PIR-Sensorcharakteristik - Reichweite/Öffnungswinkel | ca. 3 m/ca. 86° |
| Timerzeit | 30 s bis 240 s, einstellbar |
| LED-Beleuchtung | integriert, 3 LEDs, Weiß |
| Schaltleistung | 3600 VA |
| Spannungsversorgung | 230 V/50 Hz/35 mA |
| Leistungsaufnahme | max. 0,8 W |
| Gehäuse-Abmessungen (B x H x T) | 59 x 39 x 134 mm |
Der
neue Bewegungsmelder im Stecker-Steckdosen-Gehäuse ist ideal für den
Einsatz in Bereichen, in denen kurzzeitig Licht benötigt wird, ohne
einen Schalter zu betätigen. Die energiesparende und wartungsfreie
LED-Beleuchtung reicht aus, um eine Orientierung im Raum
sicherzustellen. Mit der gleichzeitig geschalteten Steckdoseneinheit
lassen sich parallel zur LED-Beleuchtung weitere Lasten bis zu einer
Leistung von 3600 VA schalten.Allgemeines
Ein
so genanntes Nachtlicht kommt immer dann zum Einsatz, wenn es darum
geht, durch eine leichte Beleuchtung eine Orientierung im Raum zu
ermöglichen. So kennzeichnet das allseits bekannte Standard- Nachtlicht
im Kinderzimmer üblicherweise den Weg zur Tür bzw. zum „großen
Lichtschalter“. In Fluren kennt man eine solche Beleuchtung als
„Notbeleuchtung“, wenn z. B. der eigentliche Lichtschalter nicht
unmittelbar erreichbar ist. Nachteil der immer leuchtenden Varianten
ist, dass der Raum stets leicht erhellt ist, was viele vor allem im
Schlafzimmer als störend empfinden, und dass diese Varianten auch
ständig Energie verbrauchen. Daher liegt es nahe, auch ein solches
Nachtlicht nur dann einzuschalten, wenn sich jemand im Raum aufhält bzw.
sich im Erfassungsbereich bewegt. Hier bietet sich eine Lösung mit
einem Bewegungsmelder an. So kann eine solche Funktion z. B. mit dem
ELVBewegungsmelder FS20 PIRI-2 (Best.-Nr.: 71-654-98) und einem
entsprechenden Funk-Schalter (z. B. FS20 ST-2, Best.-Nr.: 71-577-89),
der wiederum eine Lampe schaltet, realisiert werden. Für ein „einfaches
Nachtlicht“ ist diese Kombination aber leicht überdimensioniert; deren
Stärken liegen im Bereich der vielfältigen Konfiguration und der
universellen Einsetzbarkeit. Die Anforderungen des automatischen
Einschaltens der Beleuchtung und der universellen und vor allem
schnellen Installation erfüllt der neue ELV-Bewegungsmelder im
Stecker-Steckdosen-Gehäuse PIRS 54 in nahezu idealer Weise. Das Gerät
wird in eine freie Schuko-Steckdose eingesteckt und ist quasi sofort
betriebsbereit. Durch diese leichte Installation ist das Gerät z. B.
auch im Urlaub überall installierbar. Durch die gleichzeitig mit dem
Licht geschaltete Steckdoseneinheit sind weitere Einsatzgebiete denkbar.
Wird über die Steckdose z. B. gleichzeitig eine Klingel etc.
geschaltet, kann man mit dem PIRS 54 auch eine mobile
„Alarmierungsanlage“ aufbauen, die dann z. B. das Betreten von
„unerwünschtem Besuch“ im Hotelzimmer meldet. Das Gerät ist ideal für
den Einsatz in Räumen, in denen kurzfristig Licht benötigt wird, ohne
den Lichtschalter zu betätigen. Der PIRS 54 reagiert auf Bewegungen im
Erfassungsbereich und aktiviert die eingebaute LED-Beleuchtung
entsprechend. Parallel dazu wird die Steckdoseneinheit des Gerätes
aktiviert, womit sich dann 230-V-Verbraucher, wie z. B. größere
Leuchten, Klingeln und Sirenen etc., einschalten lassen. Das neue
ELV-LED-Nachtlicht ist mit 3 hell leuchtenden LEDs bestückt, die durch
die spezielle Abdecklinse ein diffuses, nicht blendendes Licht erzeugen.
Durch den Einsatz von LEDs ist das Gerät auch im eingeschalteten
Zustand sehr energiesparend und aufgrund der Langlebigkeit der LEDs
quasi wartungsfrei.Bedienung
Das
ELV-LED-Nachtlicht zeichnet sich auch dadurch aus, dass keinerlei
Bedienung zum Betrieb des Gerätes erforderlich ist. Das Gerät ist (je
nach Konfiguration) spätestens 4 Minuten nach dem Einstecken in die
Steckdose betriebsbereit. Während der 4-minütigen Initialisierungszeit
leuchten die LEDs als Einschaltkontrolle. Nach der Initialisierung wird
die Beleuchtung abgeschaltet, und das Nachtlicht ist betriebsbereit.
Alle Bewegungen innerhalb des ca. 3 m weiten Erfassungsbereiches werden
erkannt und daraufhin die LEDBeleuchtung und die 230-V-Steckdose für die
festgelegte Einschaltdauer (z. B. 3 Minuten) eingeschaltet. Werden
weitere Bewegungen innerhalb dieser Zeit erkannt, so verlängert sich die
Einschaltzeit wieder entsprechend, d. h. die Beleuchtung wird z. B. 3
Minuten nach der letzten Bewegung abgeschaltet. Dies heißt aber auch,
dass das Licht ständig eingeschaltet bleibt, wenn sich fortwährend
jemand im Erfassungsbereich bewegt. Die Einschaltdauer wird während des
Zusammenbaus des Gerätes mittels DIP-Schalter festgelegt (siehe
Abschnitt „Gehäuseeinbau und Endmontage“, Tabelle 1) und ist
nachträglich nicht mehr vom Bediener veränderbar. Der Erfassungsbereich
hat eine Reichweite von ca. 3 m und einen Öffnungswinkel von ca. 86°.
Man kann sich diesen als eine Art „Lichtstrahl“ vorstellen, der, von der
Erfassungslinse aus gesehen, die oben beschriebene Form hat. Zu
bedenken ist, dass hier, wie bei allen Bewegungsmeldern auf der Basis
der Passiv-Infrarot-Strahlungsmessung (PIR), das Erkennen der Bewegung
darauf beruht, dass sich ein Körper mit einer Temperatur ungleich der
Umgebungstemperatur im Erfassungsbereich bewegt. Je mehr sich die
Temperatur des bewegten Körpers von der Umgebungstemperatur
unterscheidet und je größer die Masse des bewegten Körpers ist, desto
besser wird auch dessen Bewegung erkannt. Im Umkehrschluss heißt dies z.
B., dass sich ein menschlicher Körper in einer warmen Umgebung
(Wohnzimmer) schlechter erkennen lässt als in kalter Umgebung (Garage)
und ein Erwachsener besser detektiert wird als ein Kind. Diese Parameter
wirken sich natürlich auf die Erfassungsreichweite aus. Daher kann als
Reichweite auch nur ein „Ungefährwert“ von 3 m angegeben werden – der
Wert schwankt je nach Umgebungsbedingungen zwischen 2 m und 5 m.Schaltung
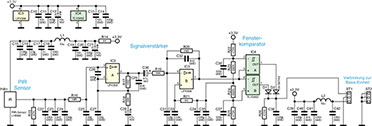
|
| Bild 1: Schaltbild der PIRS-54-Sensorplatine |
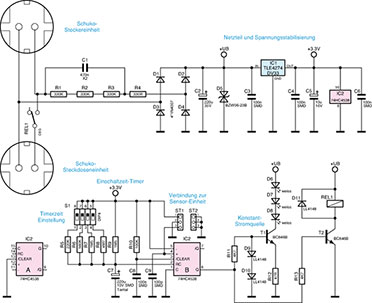
|
| Bild 2: Schaltbild der PIRS-54-Basisplatine |
Der
Wert von C 7 ist mit 220 μF fest vorgegeben, wogegen der Wert von Rx
abhängig ist von der Schalterstellung des DIP-Schalters S 1. In
Tabelle 1 sind die Zeiten in den 5 wesentlichen Schalterstellungen
(alle „Aus“, Schaltebene 1 bis 4 „Ein“) aufgelistet. Wird während der
Timerzeit eine erneute Bewegung detektiert, d. h. liegt während dieser
Zeit eine weitere Signalflanke am Eingang des Monoflops an, so beginnt
der Ladevorgang des RC-Gliedes – und damit auch die Timerzeit – von
neuem. Ist das Monoflop aktiv, so ist sein Ausgang „Q“ auf
High-Potential. Damit wird zum einen die LED-Beleuchtung eingeschal tet,
zum anderen auch das Last relais zur Steue rung der Steckdoseneinheit
geschaltet. Die drei LEDs der integrierten Beleuchtung sind hier in
Reihe geschaltet und über eine Konstantstromquelle in der Helligkeit
stabilisiert. D 9 und D 10 sorgen in Verbindung mit dem Transistor T 1
und der Stromgegenkopplung R 12 dafür, dass sich ein LED-Strom von ca.
11 mA ergibt. Damit sind die LEDs ausreichend hell ohne zu blenden. Eine
solche Stromsteuerung ist bei der Relaisansteuerung nicht notwendig,
hier arbeitet T 2 als Schalter. Die Spannungsversorgung des Gerätes
erfolgt über ein so genanntes Kondensatornetzteil. Dabei arbeitet der
Folienkondensator C 1 in Verbindung mit dem Widerstand R 4 und der
Transil-Diode D 5 prinzipiell als Spannungsteiler. Der Kondensator sorgt
in diesem Fall dafür, dass die durch den Laststrom hervorgerufene
Leistung größtenteils als Blindleistung anfällt und nicht „bezahlt“
werden muss (die Wirkleistungsaufnahme liegt bei <1 W). Durch die
hier gegebene Dimensionierung ergibt sich für die Gleichspannung „UB“
ein Wert von 18 V bis 26 V, je nach Lastfall. Um für die Zeitsteuerung
und für den Sensorteil der Schaltung definierte Verhältnisse zu
bekommen, stabilisiert der Spannungsregler IC 1 die Betriebsspannung
hierfür auf 3,3 V. Damit ist die Schaltung ausführlich erläutert und es
folgen die Anweisungen zum Aufbau des Gerätes. Nachbau
Der
Nachbau des LED-Nachtlichtes gliedert sich in den Aufbau der Platinen
(Sensorplatine und Basisplatine) und den Gehäuseeinbau. Zum Nachbau ist
folgender Sicherheitshinweis zu beachten: Achtung! Aufgrund der im Gerät
frei geführten Netzspannung dürfen Aufbau und Inbetriebnahme
ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund ihrer
Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen Sicherheits- und
VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. Außerdem ist bei allen
Arbeiten am geöffneten Gerät, z. B. bei der Reparatur, ein
Netztrenntransformator zu verwenden. Der Aufbau der Platinen erfolgt in
gewohnter Weise anhand der Stückliste, des Bestückungsdruckes und des
Schaltbildes. Die jeweiligen Platinenfotos zeigen hilfreiche
Detailinformationen. Auf beiden Platinen sind die gesamten SMD-Bauteile
bereits vorbestückt. Somit beschränkt sich der Nachbau auf die
Bestückung der bedrahteten Bauelemente und den Einbau ins Gehäuse.Basisplatine
Zum
Aufbau der Basisplatine sind zunächst der Monoflop IC 2 und der
DIPSchalter S 1 zu bestücken. Hier ist beim Einbau des ICs die korrekte
Polung, die durch die Gehäusekerbe am IC und die entsprechende
Markierung im Bestückungsdruck festgelegt ist, sicherzustellen. Auch der
DIP-Schalter ist entsprechend des Bestückungsdruckes einzusetzen.
Anschließend folgt der Einbau der Kondensatoren – bei den
Elektrolyt-Typen ist die korrekte Polung durch die Kennzeichnung des
Minuspols am Bauteil markiert. Aus Platzgründen sind die nun zu
montierenden Dioden D 1 bis D 4 und der Widerstand R 4 stehend
einzusetzen. Auch hier ist bei den Dioden die korrekte Polung zu
beachten. Einzelheiten zum Einbau sind dem Platinenfoto zu entnehmen.
Die Transil-Diode D 5 wird zwar wie gewohnt liegend montiert, muss aus
thermischen Gründen aber so eingelötet werden, dass sich zwischen
Diodenkörper und Platine ein Abstand von ca. 3 mm ergibt. In die
Positionen der Steckverbinder ST 1 und ST 2 sind hier die 3-poligen
Buchsenleisten einzusetzen. Vor dem nun folgenden Einbau der LEDs ist
noch das Relais zu bestücken. Um hier den späteren Anschluss der
Steckdoseneinheit zu vereinfachen, sollten die vier Schaltkontakte des
Relais noch nicht an die dafür vorgesehenen Lötflächen angelötet werden.
Die LEDs sind vor der Montage auf der Platine in den dafür vorgesehenen
Halter zu setzen. Hierzu geben die Abbildungen 3 bis 6 hilfreiche
Zusatzinformationen.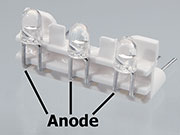
|
| Bild 3: Einsetzen der LEDs in die LED-Aufnahme |

|
| Bild 4: Aufsetzen des Reflektors |

|
| Bild 5: Fertig montierter LED-Reflektor, Ansicht von schräg oben |

|
| Bild 6: Fertig montierter LED-Reflektor |
Sensorplatine
Auch
der Aufbau dieser Platine beschränkt sich auf die Montage der bedrah
teten Bauelemente. Bis auf die beiden Stiftleisten, die in die
Positionen der Steckverbinder ST 1 und ST 2 auf der Lötseite (!) zu
montieren sind, werden alle Bauteile auf der Bestückungsseite
entsprechend des Bestückungsdruckes eingesetzt. Besondere Vorsicht muss
man beim Einbau des PIR-Sensors PIR 1 walten lassen: Um eine optimale
Positionierung der optischen Einheit Sensor und Lin se zu gewährleisten,
wird der Sensor quasi in der Linse montiert. Dazu muss der PIRSensor
zunächst so tief wie möglich in das Linsenunterteil eingesetzt werden
(Achtung: Sensoroberfläche nicht berühren). Die korrekte Orientierung
legt dabei die Nut am Linsenträger fest, in die die „Nase“ des
Sensorgehäuses eintaucht. Anschließend wird diese Einheit so auf der
Platine positioniert, dass sich kein Spalt zwischen Sensor bzw.
Linsenträger und Platine ergibt – die korrekte Polung ergibt sich
automatisch durch die Pin-Anordnung. Nach der Montage ist das Oberteil
der Linse aufzusetzen. Die korrekte Orientierung ist hier durch
verschiedene Einkerbungen und Rastungen an beiden Linsenteilen gegeben.
Die weiterhin noch zu bestückenden Elektrolyt-Kondensatoren sind
entsprechend ihrer Polung liegend zu montieren. Auch hier zeigt das
Platinenfoto Details zum Aufbau. Damit sind die Aufbauarbeiten an den
Platinen abgeschlossen und es erfolgt der Einbau ins Gehäuse.Gehäuseeinbau und Endmontage
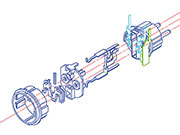
|
| Bild 7: Zusammenbau des Steckdoseneinsatzes |
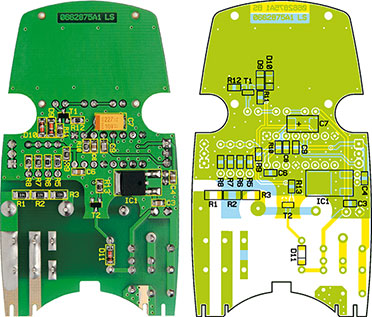
|
| Ansicht
der fertig bestückten Basisplatine des PIRS 54 mit zugehörigem
Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |
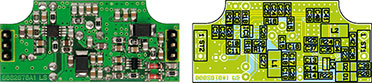
|
| Ansicht
der fertig bestückten Sensorplatine des PIRS 54 mit zugehörigem
Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (6 Seiten)
als PDF (6 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder PIRS 54
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo





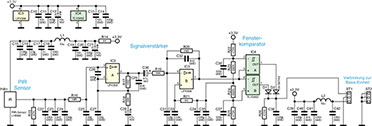
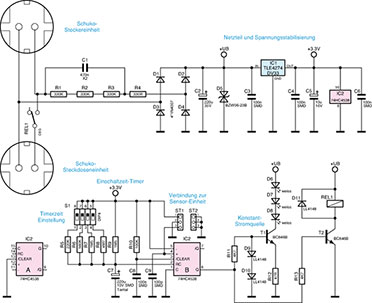


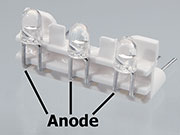


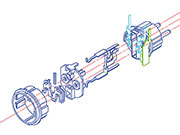
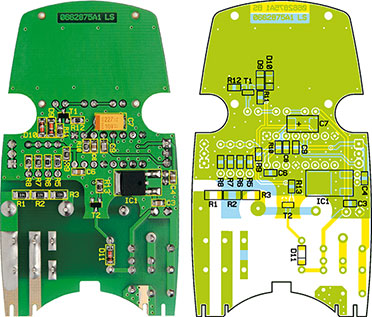
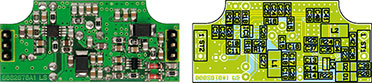
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (6 Seiten)
als PDF (6 Seiten)