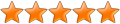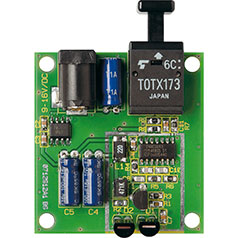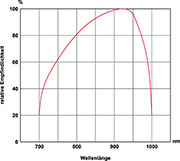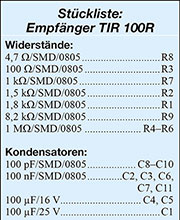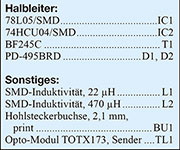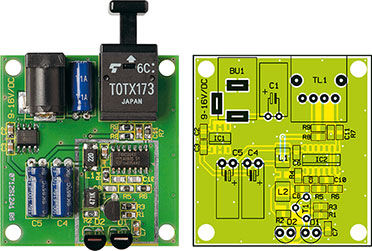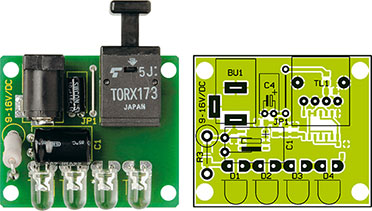Toslink-Signale über Infrarot TIR 100
Aus ELVjournal
01/2007
0 Kommentare
Technische Daten
| Bandbreite | 100 kHz bis 6 MHz |
| IR-Reichweite | bis 3 m |
| Sendeeinheit TIR 100T | |
| Signal-Eingang | S/PDIF (optisch) |
| Signal-Ausgang | 4 IR-Sendedioden |
| Spannungsversorgung | 11–14 VDC |
| Stromaufnahme | 160 mA |
| Platinenabmessungen | 40 x 34 mm |
| Empfangseinheit TIR 100R | |
| Signal-Eingang | 2 IR-Empfangsdioden |
| Signal-Ausgang | S/PDIF (optisch) |
| Spannungsversorgung | 8–16 VDC |
| Stromaufnahme | 80 mA |
| Platinenabmessungen | 45 x 42 mm |
Die
Verkopplung digitaler Audiogeräte erfolgt entweder mit Koax-Kabeln oder
mit Lichtwellenleitern. Mit der hier vorgestellten kleinen Schaltung
kann nun auch eine Strecke ohne physikalische Verbindung mit Hilfe von
Infrarotlicht überwunden werden.Allgemeines
Um
Verluste und Signalbeeinträchtigungen zu vermeiden, ist es sinnvoll,
Audiogeräte digital miteinander kommunizieren zu lassen. Als Standard
für digitale Audio- Signale hat sich das S/PDIF-Format seit vielen
Jahren durchgesetzt, wobei die Signale entweder direkt über Koax-Kabel
übertragen werden oder es erfolgt eine Umwandlung in Lichtsignale, wobei
dann als Übertragungsmedium Kunststoff-Lichtwellenleiter eingesetzt
werden. Zur Signal- Ein- und -Auskopplung werden dabei nahezu
ausschließlich die so genannten Toslink-Steckverbinder genutzt. Die
meisten Geräte der Unterhaltungselektronik wie CD-Player, DVD-Player,
Sat-Receiver, Surround-Anlagen usw. sind bereits mit
Toslink-Schnittstellen ausgerüstet. Lichtwellenleiter mit fertig
konfektionierten Steckverbindern sind in Längen bis zu 10 m erhältlich.
Geräteseitig ist in den Steckverbindern bereits die Sende- und
Empfangselektronik integriert. Toslink- Module sind daher vielseitig
einsetzbar, wobei die optimale Ankopplung der Sendeund Empfangsdioden an
den Lichtwellenleiter durch die mechanische Konstruktion sichergestellt
ist.Kunststoff-Lichtwellenleiter haben das Dämpfungsminimum im
sichtbaren Lichtbereich, bei ca. 570 nm.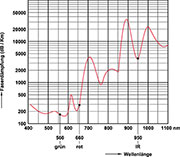
|
| Bild 1: Dämpfung von Kunststoff-LWL in dB/km in Abhängigkeit von der Wellenlänge der Strahlung |
Eine
Herausforderung ist dabei die Übertragungsbandbreite des
S/PDIF-Signals, die mit 100 kHz bis 6 MHz spezifiziert ist, und die
damit verbundenen kurzen Schaltzeiten. Bei 48 kHz Abtastfrequenz beträgt
die Signal-Bitrate 3,1 MHz, womit 160-ns-Impulse zu übertragen sind. Da
Standard-Infrarot-Sendedioden nicht in der Lage sind, Signale mit
derart kurzen Schaltzeiten zu übertragen, wurden sehr schnelle
Spezial-IR-Sendedioden ausgewählt. Die Anstiegs- und Abfallzeiten der
eingesetzten Typen von Avago betragen nur 40 ns. Die Dioden des Typs
HDSL 4230 haben eine sehr hohe Strahlungsintensität und mit 17° einen
engen Abstrahlwinkel. Im Gegensatz zu den meisten IR-Sendedioden liegt
das Maximum der Strahlung nicht bei 950 nm, sondern bei 875 nm. 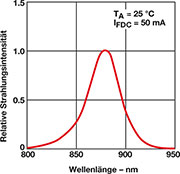
|
| Bild 2: Strahlungsmaximum der Sendediode in Abhängigkeit von der Wellenlänge der Strahlung |
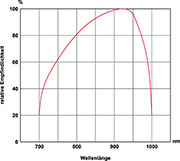
|
| Bild 3: Spektrale Empfindlichkeit der IR-Empfangsdiode PD-495BRD |
IR-Sender
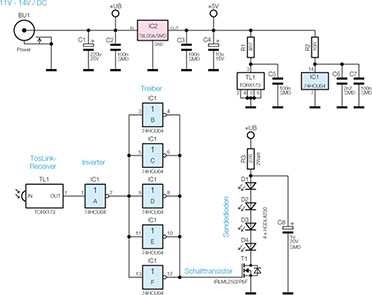
|
| Bild 4: Schaltbild des Sendemoduls TIR 100T |
IR-Empfänger
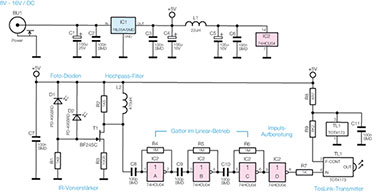
|
| Bild 5: Schaltbild der Empfangseinheit TIR 100R |
Nachbau
Da
bereits alle SMD-Komponenten werkseitig vorbestückt sind, ist der
praktische Aufbau einfach und schnell erledigt. Von Hand sind somit nur
noch die konventionellen, bedrahteten Bauteile zu verarbeiten. Den
Nachbau beginnen wir mit der Empfängerplatine, wo zuerst das Toslink-
Transmittermodul TOTX 173 eingesetzt wird. Beim Verlöten ist darauf zu
achten, dass das Bauteil plan auf der Platinenoberfläche aufliegt. Die
Verarbeitung der DC-Buchse BU 1 erfolgt in derselben Weise. Beim Einbau
der Elektrolyt-Kondensatoren in liegender Postition ist unbedingt die
korrekte Polarität zu beachten. Falsch gepolte Elkos können sogar
explodieren. Nach dem Verlöten werden die überstehenden Drahtenden
direkt oberhalb der Lötstellen mit einem scharfen Seitenschneider
abgeschnitten. Die Anschlüsse des Transistors T 1 sind vor dem Verlöten
so weit wie möglich durch die zugehörigen Platinenbohrungen zu führen
und nach dem Verlöten werden die überstehenden Drahtenden abgeschnitten.
Jetzt bleiben nur noch die beiden Infrarot- Empfangsdioden zu
bestücken. Diese werden, wie auf dem Platinenfoto zu sehen, eingelötet
und die überstehenden Drahtenden an der Platinenunterseite
abgeschnitten. Bei der jetzt zu bestückenden Infrarot- Sendeeinheit ist
zuerst eine Brücke aus versilbertem Schaltdraht einzulöten. Danach sind
der Toslink-Receiver TORX 173 und die DC-Buchse BU 1 an der Reihe. Die
Bauteile müssen, wie die vergleichbaren Bauteile bei der
Empfangseinheit, vor dem Verlöten plan auf der Platinenoberfläche
aufliegen. Auch bei der Senderplatine werden die Elkos liegend, unter
Beachtung der korrekten Polarität, bestückt. Wie auf dem Platinenfoto zu
sehen ist, ist der Widerstand R 3 in stehender Position einzulöten. Bei
den Sendedioden ist die Anodenseite des Bauteils durch einen längeren
Anschluss gekennzeichnet und die Katodenseite des Gehäuses ist
abgeflacht. Die Bauteile sind wie auf dem Platinenfoto gezeigt
abzuwinkeln und die Anschlüsse von oben durch die zugehörigen
Platinenbohrungen zu führen. Nach dem Verlöten an der Platinenunterseite
sind alle überstehenden Drahtenden direkt oberhalb der Lötstellen
abzuschneiden. Nachdem nun beide Baugruppen fertig bestückt sind, steht
dem Einsatz nichts mehr entgegen. Eine sorgfältige Ausrichtung der
Sende- und Empfangsdioden sorgt für die bestmögliche Reichweite.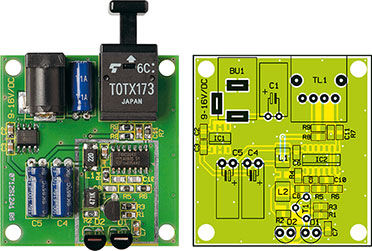
|
| Ansicht der fertig bestückten Empfangsplatine mit zugehörigem Bestückungsplan |
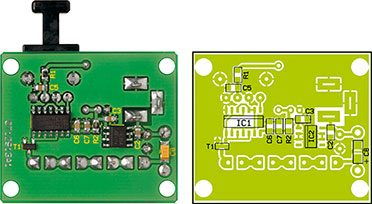
|
| Ansicht
der fertig bestückten Senderplatine mit zugehörigem Bestückungsplan,
oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Toslink-Signale über Infrarot TIR 100
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo
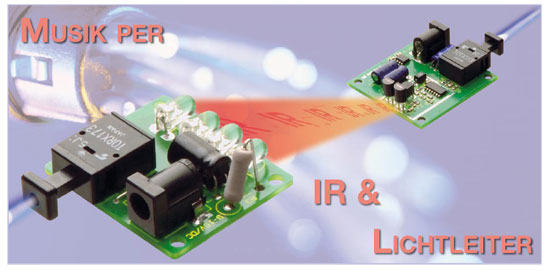




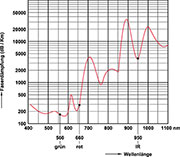
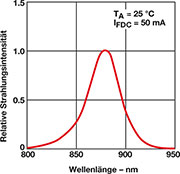
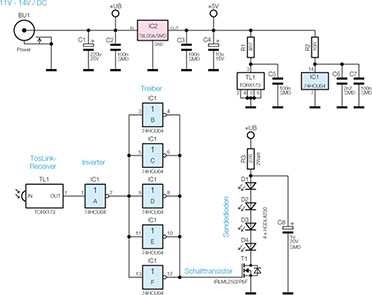
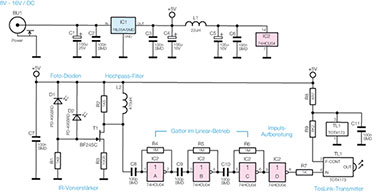
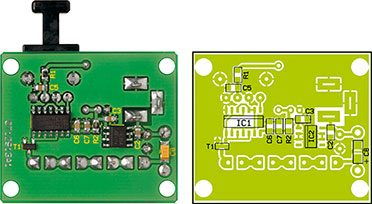
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)