10-MHz-DDS-Funktionsgenerator DDS 110 Teil 2/2
Aus ELVjournal
02/2007
0 Kommentare
Alles rund um den Controller
Die
Steuerung der gesamten Schaltung und die Kommunikation mit dem
angeschlossenen PC übernimmt der Mikrocontroller IC 1.
Für den Betrieb des Mikrocontrollers wird neben dem Keramikschwinger Q 1
zur Takterzeugung die Reset-Schaltung aus R 5, C 2 und D 11 benötigt.
Wie beim 25-MHz-Quarzoszillator, wurde auch hier eine Entkopplung zur
Versorgungsspannung umgesetzt, um eventuelle Störungen des
Mikrocontrollers zu minimieren. Dazu wird die Spule L 1 in Verbindung
mit den Kapazitäten C 17 bis C 20 genutzt.
Neben der Steuerung des DDS-Bausteins übernimmt der Mikrocontroller IC 1
auch die Steuerung des Relais REL 1 mit Hilfe des Transistors T 1.
Damit beim Ausschalten des Relais keine hohen Spannungsspitzen
entstehen, ist die Diode D 12 parallel zum Relais angeordnet. Am
Port-Pin PC 6 von IC 1 befindet sich der externe Modulationseingang
„Mod.-in PM“. Der Synchronisationsausgang „Sync.-out“ für die
Betriebsart „Wobbeln“ wird durch den Port-Pin PC 5 angesteuert.
Mit den drei Datenleitungen PD 5, PD 6 und PD 7 des Mikrocontrollers
wird der Digital-Analog-Wandler IC 2 vom Typ LTC1658 gesteuert. Dieser
D/A-Wandler besitzt eine Auflösung von 14 Bit und
erhält am Pin 6 (REF) eine Referenzspannung von 2,5 V. Diese
Referenzspannung wird mit der Spannungsreferenzdiode D 14 erzeugt. Je
nach Einstellung durch den Mikrocontroller steht nun am Ausgang „Vout“
des DA-Wandlers eine Spannung zwischen 0 V und 2,5 V zur Verfügung.
Diese Spannung wird auf den Eingang (Pin 6) des als summierenden
Inverter arbeitenden Operationsverstärkers IC 3 B vom Typ TLC277C
gegeben.
Mit Hilfe dieses Verstärkers und der entsprechenden Beschaltung aus R
10, R 12, R 8, R 3, C 3 entsteht am Ausgang (Pin 7) die Steuerspannung
für die Endstufe im Bereich von -1 V bis +1 V. An der BNC-Buchse
„Mod.-in AM“ befindet sich ein zweiter Operationsverstärker, der als
reiner Impedanzwandler eingesetzt ist. An seinem Eingang befindet sich
der Kondensator C 1, über den der DC-Anteil des eingespeisten
Modulationssignals eliminiert wird. Falls die BNC-Buchse extern
unbeschaltet ist, wird der Eingang des OPs über den Widerstand R 4
definiert auf Masse gezogen. Das Ausgangssignal am Pin 1 des
Operationsverstärkers gelangt über den Widerstand R 2 ebenfalls auf die
oben beschriebene Addierstufe IC 3 B und wird
so dem Steuersignal überlagert. Das inver-
tierte Signal der aufsummierten Spannungen
(Pin 7) wird über den Widerstand R 7 auf den Eingang „VG“ (Pin 2) der
Endstufe LMH6503MA gelegt. Dieses Signal wird, wie in Teil 1 erwähnt,
genutzt, um den Verstärkungsfaktor der Endstufe zu ändern.USB-Wandler
Die
Datenverbindung zwischen dem PC und dem DDS-Board erfolgt über die
USB-Schnittstelle. Um die Kommunikation zwischen USB-Schnittstelle und
Mikrocontroller zu ermöglichen, ist der USB-TTL-Wandler IC 4
zwischengschaltet. Zwischen dem Mikrocontroller IC 1 und dem IC 4
besteht eine serielle Datenverbindung via „RxD“ und „TxD“.
Da der USB-TTL-Wandler intern mit einer Spannung von 3,3 V arbeitet,
sind
am Datenausgang „TxD“ zwei Schmitt-Trigger von Typ 74HCT14 in Reihe
geschaltet. Sie sorgen unter Berücksichtigung der Signalinvertierung für
eine Anhebung des Signalpegels auf 5 V. Die Kondensatoren C 4 bis C 6
werden zur Entstörung und Stabilisierung genutzt, als Reset-Schaltung
benötigt man hier nur den Widerstand R 1.
Der Mikrocontroller steuert über den Port-Pin PB 0 die rote „USB“-LED D
13 an und signalisiert so, dass die serielle Datenverbindung aufgebaut
wurde.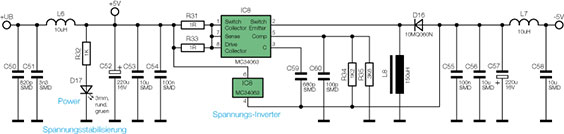
|
| Bild 8: Schaltbild der Spannungsversorgung |
Nachbau
Die
Platine wird bereits mit SMD-Bauteilen bestückt geliefert, so dass nur
die bedrahteten Bauteile zu bestücken sind. Die Bestückung der
bedrahteten Bauteile erfolgt in gewohnter Weise anhand der Stückliste
und des Bestückungsplans.
Zuerst sind der 25-MHz-Quarzoszillator Q 2 und das Relais REL 1 zu
bestücken. Anschließend werden die vier Lötstifte an den Buchsen BU 2
bis BU 5 eingesetzt und sorgfältig von der Lötseite her angelötet. Im
nächsten Schritt erfolgt der Einbau der Elkos C 13, C 21, C 52 und C 57.
Beim Einsetzen der Elektrolyt‑Kondensatoren ist auf die richtige
Einbaulage bzw. die richtige Polung zu achten. Sie sind in den meisten
Fällen am Minus-Anschluss gekennzeichnet.
Anschließend wird nun die USB-Buchse BU 1 eingesetzt, hierbei ist darauf
zu achten, dass auch das Gehäuse der USB-Buchse an die Platine
angelötet wird.
|
| Bild 9: So erfolgt das Verlöten der BNC-Buchsen. |
Inbetriebnahme und Kalibrierung
Nutzer
des Betriebssystems Windows XP und Windows 2000 können nun das
DDS-Board zur ersten Inbetriebnahme an einen USB-Port des Computers
anschließen, die grüne „Power“-LED sollte nun leuchten.
Der PC erkennt die neu angeschlossene Hardware und verlangt nach kurzer
Zeit einen USB-Treiber.
Dieser Treiber (DDS110.inf) befindet sich auf der mitgelieferten
Programm-CD im Ordner „ELV_DDS110_Drivers“. Die zwischenzeitliche
Warnung, dass es sich um einen unsignierten Treiber ohne Windows-Logo
handelt, ist dabei zu ignorieren.
Unter Windows 98 SE bzw. Windows Me
ist vor dem Anschließen des DDS 110 die Datei „Preinstaller.exe“
auszuführen. Sie befindet sich ebenfalls im Ordner „ELV_DDS110_Drivers“.
Anschließend kann das DDS-Board mit dem PC verbunden werden.
Nach der Installation des Treibers kann die ebenfalls auf der CD
befindliche PC-Software installiert und gestartet werden. Um die
Software optimal bedienen zu können, ist eine Bildschirmauflösung von
mindestens 1024 x 768 Bildpunkten notwendig.
|
| Bild 10: Geöffneter Menüpunkt „Kalibrierung“ |
Als
Erstes wird hier der Menüpunkt „Offset“ ausgewählt, um einen eventuell
auftretenden Offset zu kompensieren. Das sich öffnende Fenster
(Abbildung 12) beinhaltet eine Anleitung, in der alle notwendigen
Schritte aufgelistet sind. Um die Kompensierung des Offset umsetzen zu
können, muss die Lötbrücke JP 1 geöffnet sein (Abbildung 11).
Mit einem Multimeter wird die am Signal-Ausgang „Signal-out“ anliegende
Gleichspannung gemessen. Nachdem die Schaltfläche „minimale Amplitude“
betätigt worden ist, wird mit Hilfe des Trimmers R 15 der
Gleichspannungsanteil auf 0 V eingestellt. Anschließend wird die
Schaltfläche „maximale Amplitude“ gedrückt und der jetzt gemessene
Gleichspannungsanteil mit dem Trimmer R 25 wieder auf 0 V eingestellt.
Die Einstellung wird mit dem Button „Schließen“ beendet. 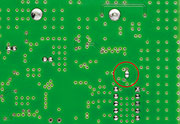
|
| Bild 11: Lage der Lötbrücke |

|
| Bild 12: Offset-Kalibrierung |

|
| Bild 13: Kalibrierung der Amplitude |
Mit
einem Multimeter wird die am Signal-Ausgang „Signal-out“ anliegende
Gleichspannung gemessen. Nachdem die Schaltfläche „minimale Amplitude“
betä-tigt worden ist, wird mit Hilfe des Trimmers R 15 der
Gleichspannungsanteil auf 0 V eingestellt. Anschließend wird die
Schaltfläche „maximale Amplitude“ gedrückt und der jetzt gemessene
Gleichspannungsanteil mit dem Trimmer R 25 wieder auf 0 V eingestellt.
Die Einstellung wird mit dem Button „Schließen“ beendet.
Der nächste Punkt ist die Kalibrierung der Signalamplitude, Abbildung 13
zeigt das geöffnete Fenster, nachdem dieser Menüpunkt angewählt ist.
Auch in diesem Fenster ist eine Anleitung mit den notwendigen Schritten
zu sehen. Für die Kalibrierung der Amplitude muss im Hauptfenster eine
Frequenz von 1 kHz eingestellt und am Signal-Ausgang eine Last in Form
eines 50-Ω-Abschlusswiderstands angeschlossen werden. Zudem wird ein
Messgerät benötigt, mit dem Spitze-Spitze-Spannungen gemessen werden
können, z. B. ein Oszilloskop.
Mit dem Schieberegler wird eine Ausgangsspannung von 0,2 Vss bzw. 0,8
Vss eingestellt und mit dem dazugehörigen Button quittiert. Danach
erfolgt die Bestätigung der eigentlichen Kalibrierung mit dem Klick auf
„Kalibrierdaten senden“. Mit dem Befehl „Schließen“ wird das Fenster
geschlossen.
Als Letztes erfolgt die Kalibrierung der Ausgangsfrequenz. Falls jedoch
die von Quarzoszillator Q 2 gegebene Genauigkeit von 25 ppm ausreicht,
kann dieser Schritt übersprungen werden. 
|
| Bild 14: Kalibrierung der Frequenz |
Endmontage, Anschluss und Einbau

|
| Bild 15: Montiertes Abschirmgehäuse |
Wichtig:
Um für das DDS-Board einen ausreichenden ESD-Schutz zu gewährleisten, muss es in das dafür vorgesehene Gehäuse eingebaut werden.
Datenblatt AD9833: :
Internetseite des Herstellers: http://www.analog.comFachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- 10-MHz-DDS-Funktionsgenerator DDS 110 Teil 2/2
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
| weitere Fachbeiträge | Foren | |
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo





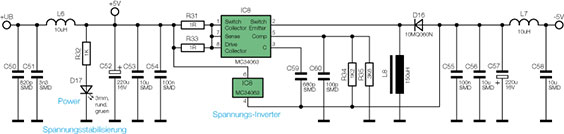




 als Online-Version
als Online-Version als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)