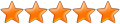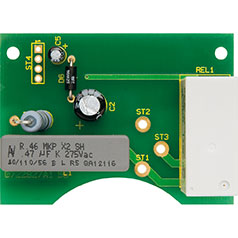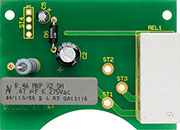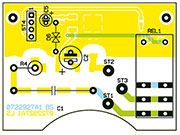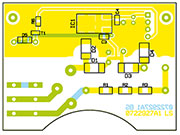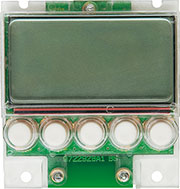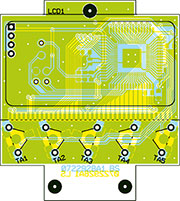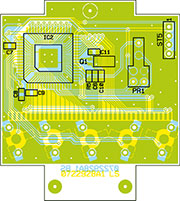Intervall-Schalter IVS 53
Aus ELVjournal
02/2007
0 Kommentare
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 230 V/50 Hz/
0,5 W |
| Schaltausgang | 3600 W/16 A |
| Schaltzeiten | 1 Sek. bis 99 Std. |
| Abm. (B x H x T) | 131 x 77 x 68 mm |
Der
universell einsetzbare Timer, wenn es darum geht,
Geräte in einem bestimmten Zeitintervall ein- und auszuschalten! Die
Ein- und Ausschaltzeiten sind in einem Bereich von 1 Sekunde bis 99
Stunden einstellbar. Die Bedienung des praktischen Gerätes wurde bewusst
einfach gehalten, so das z. B. keine Uhrzeiten, sondern lediglich die
Zeitintervalle für das Ein- und Ausschalten eingestellt werden.Intervalle – einfach und praktisch
Jeder
Autofahrer kennt den praktischen Wert eines Intervall-Schalters –
einmal aktiviert und das Intervall gewählt, entlastet der uns vom
lästigen Ein- und Ausschalten der Scheibenwischer bei leichtem
Niederschlag, Nebel usw.
Solch eine Schaltung kann man aber auch woanders einsetzen, einfach
überall da, wo man für eine gewisse Zeit irgendetwas automatisch ein-
und ausschalten will. Einsatzfälle gibt es viele – der Auslöser für
unseren Entwickler war die Installation einer kleinen Pool-Anlage. Das
Badewasser wollte er mit einem in der prallen Sonne platzierten
schwarzen Gartenschlauch erwärmen (das kann im Garten selbst, auf dem
Garagen- oder Schuppendach oder ähnlichen, gut beschienenen Orten sein,
einfach mäanderförmig möglichst viel Schlauchlänge auslegen) und mit
einer Umwälzpumpe immer wieder das erwärmte Wasser in den Pool und von
dort abgekühltes Wasser zurück in das Schlauchsystem pumpen. So weit, so
gut. Aber ein ständiger Umwälzbetrieb kostet viel Strom und der
Erwärmungseffekt geht durch das ständige Durchpumpen schnell verloren.
Also musste eine gewisse Zeit gewartet werden, bis sich das Wasser in
dem schwarzen Schlauch schön erwärmt hat, um erst dann für eine kurze
Zeit eine Zirkulation auszulösen, die gerade ausreicht, das komplette
Flüssigkeitsvolumen im Schlauch einmal auszutauschen. Hierfür stieß eine
normale Schaltuhr systembedingt an ihre Grenzen – verfügt sie doch nur
über wenige Schaltzeiten je Tag, ist somit für diesen Zweck unbrauchbar.
Ergo musste ein Intervall-Schalter ähnlich wie der im Auto her! Der
wird einfach frühmorgens gestartet und schaltet die Pumpe in
einstellbaren Intervallen ein und aus. Das spart viel Elektroenergie und
sichert einen optimalen Erwärmungseffekt.Ähnliche
Anwendungsbeispiele werden wohl jedem einfallen, der Haus und Garten
hat. Im Sommer kann der Intervall-Schalter im Garten eingesetzt werden,
etwa zum Rasen- oder Gartensprengen (spart viel Wasser und man
verhindert, dass der Garten zur Seenlandschaft wird, wenn man den
Sprenger mal „vergisst“), im Rest des Jahres erfüllt der dank
Stecker-Steckdosen-Gehäuse einfach umsetzbare Automatikschalter etwa
eine Aufgabe als einfache Anwesenheitssimulation, indem man ihn während
der Abwesenheit das Licht in einem Raum schalten lässt. Setzt man hierzu
gleich zwei oder drei Intervall-Schalter abgestimmt in verschiedenen
Räumen ein, gerät das Ganze schon in die Nähe einer perfekten
Anwesenheitssimulation.
Und zusätzlich kann das Gerät auch noch als Ausschalt-Timer dienen. So
kann man das Bügeleisen garantiert nicht vergessen, das Licht bleibt
noch eine gewisse Zeit an, eine Pumpe läuft nur einmalig für die
gewünschte Zeit usw. Dank des recht einfachen Aufbaus unseres
Intervall-Schalters ist dieses Accessoire auch recht preisgünstig und
wird sich schnell rentieren. Denn wir haben hier auf eine integrierte
Uhr verzichtet, lediglich eine einfache Ablaufsteuerung verrichtet ihre
Arbeit. Nicht verzichten muss der Anwender auf Bedienkomfort – alle
Einstellungen werden über ein LC-Display kontrolliert, so ist man immer
im Bilde über den Ist-Zustand und kann die gewünschten Zeiten einfach
eingeben. Bedienung und Programmierung

|
| Bild 1: Alle verfügbaren Segmente des eingesetzten Displays |
Manueller Betrieb
Zum
manuellen Schalten der angeschlossenen Last sind die Tasten „ON“ und
„OFF“ vorgesehen.
Ein Tastendruck auf „ON“ schaltet die Last ein, und entsprechend wird
mit „OFF“ die Last wieder ausgeschaltet. Der Schaltzustand wird im
Display durch die Segmente „EIN“ und „AUS“ dargestellt.Automatikbetrieb
Im
Automatikmodus, angewählt durch die Taste „AUTO“, werden die
programmierten Ein- und Ausschaltzeiten kontinuierlich wiederholt. Mit
welcher Sequenz das Gerät beginnen soll, kann man dadurch festlegen,
welche Taste vor der Taste „AUTO“ gedrückt wurde. Drückt man z. B.
zuerst die Taste „ON“ und danach die Taste „AUTO“, beginnt die Sequenz
mit der Einschaltzeit. Die verbleibende Zeit, bis ein Wechsel des
Schaltzustands stattfindet, wird durch die „Restzeit“ im unteren Teil
des Displays angezeigt.Ausschalt-Timer
Der
Intervall-Schalter ist auch als Ausschalt-Timer nutzbar, der nach einer
bestimmten Zeit einen Verbraucher ausschaltet. Diese Funktion kann auf
einfache Weise aktiviert werden, indem man die Ausschaltzeit auf
00:00:00 setzt. Betätigt man die Taste „ AUTO“, wird der Verbraucher für
den Zeitraum der programmierten Einschaltzeit eingeschaltet.Schaltung
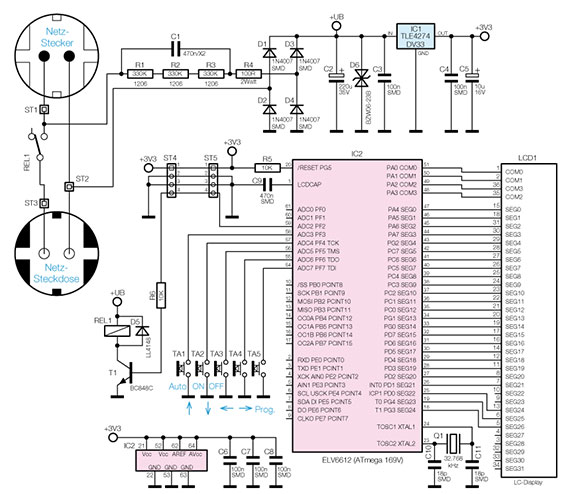
|
| Bild 2: Schaltbild des IVS 53 |
Achtung!
Aufgrund
der im Gerät frei geführten Netzspannung dürfen Aufbau und
Inbetriebnahme ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden, die
aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen
Sicherheits- und VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. Außerdem
ist bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät, z. B. bei der Reparatur,
ein Netztrenntransformator zu verwenden.Nachbau
Die
Bestückung der Platine erfolgt gemischt mit SMD- und bedrahteten
Bauteilen. Die SMD-Bauteile sind schon vorbestückt, so dass hier
lediglich eine abschließende Kontrolle der bestückten Platine auf
Bestückungsfehler, eventuelle Lötzinnbrücken, vergessene Lötstellen usw.
notwendig ist.
Wir beginnen zunächst mit der Bestückung der Netzteilplatine. Die
Bestückung der bedrahteten Bauteile erfolgt in gewohnter Weise anhand
der Stückliste, des Bestückungsdruckes und des Schaltbildes. Die
Bauteile werden auf der Platinenunterseite verlötet, überstehende
Drahtenden mit dem Seitenschneider gekürzt. Beim Bestücken vieler
Bauteile ist auf die richtige Einbaulage zu achten. Am Gehäuse der Elkos
C 2 und C 5 ist der Minus-Pol gekennzeichnet. Die Diode D 6 besitzt
keine Polung.
Im nächsten Arbeitsschritt werden die Verbindungsleitungen zwischen
Netzteil- und Anzeigenplatine angefertigt. Diese bestehen aus jeweils
einem 8 cm langen Stück Litze (0,22 mm²). Es stehen verschiedenfarbige
Leitungen zur Verfügung, um beim Anlöten an die Anzeigeplatine ein
Verwechseln zu verhindern. Für die beiden mittleren Masseverbindungen
nimmt man zweckmäßigerweise die Farbe Schwarz. Die beiden äußeren
Leitungen sind beliebig wählbar. Die Leitungen werden zunächst nur auf
der Netzteilplatine angelötet.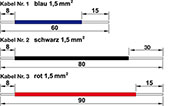
|
| Bild 3: Anzufertigende Kabelabschnitte für den Anschluss der Steckereinheit |
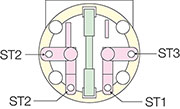
|
| Bild 4: Anschlussbelegung der Steckereinheit |

|
| Bild 5: Die fertig verdrahtete Steckereinheit |

|
| Bild 6: Das montierte Display |

|
| Bild 7: Einzelne Komponenten des Displays |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (5 Seiten)
als PDF (5 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Intervall-Schalter IVS 53
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo
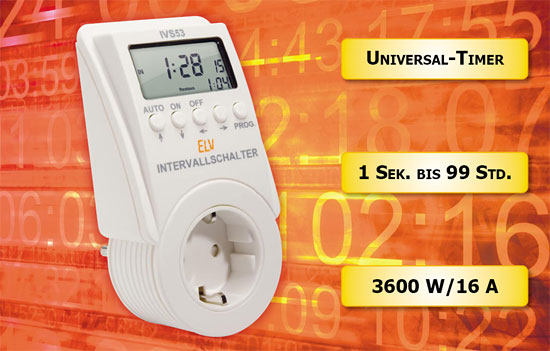





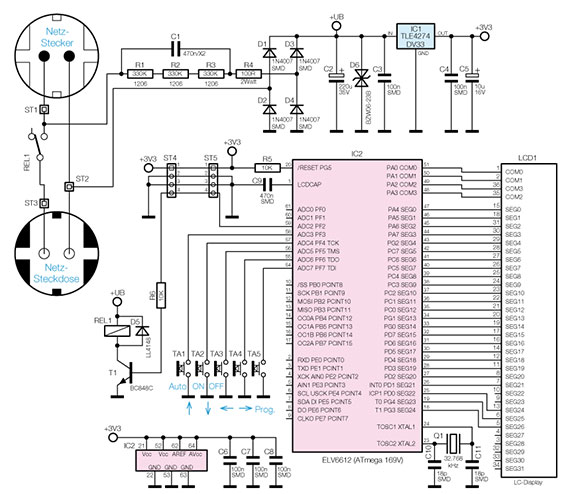
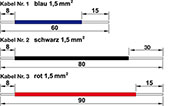
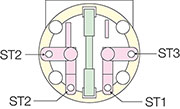



 als Online-Version
als Online-Version als PDF (5 Seiten)
als PDF (5 Seiten)