Kfz-Leistungsmesser KL 100 – zeigt, was in Ihrem Motor steckt Teil 2/4
Aus ELVjournal
03/2007
0 Kommentare
Technische Daten
| Betriebsspannung | 9–15 VDC |
| Stromaufnahme | max. 100 mA |
| Tachosignal | |
| Signalform | Rechteck, Sinus o. Ä. |
| Amplitude | min. 0–5 V, max. 0–16 V |
| Frequenz | 1000–65.535 Pulse pro km |
Der
KL 100 ermittelt anhand eines elektronischen Tachosignals, das bei
vielen Pkw bereits bis zum Autoradio-Einbauschacht gelegt ist, die
Fahrzeuggeschwindigkeit und die Beschleunigungsdaten des Fahrzeugs. Nach
Eingabe der Fahrzeugmasse und einer Messfahrt kann das Gerät die
Motorleistung bestimmen. Es laufen Kilometerzähler und unter
Berücksichtigung der Reibung auch Energiezähler mit, die Rückschlüsse
auf das Fahrverhalten ziehen lassen. Die Messwerte und Einstellungen
lassen sich über ein LC-Display verwalten. Im zweiten Teil des Artikels
widmen wir uns Schaltungstechnik, Aufbau, Installation und Bedienung des
Kfz-Leistungsmessers.Hinweis: Der KL 100 ist als Bausatz nicht im Bereich der StVZO zugelassen. Schaltung

|
| Bild 11: Schaltbild des KL 100 |
Abbildung
11 zeigt das Schaltbild des
KL 100. Da der KL 100 aus dem Tachosignal des Kfz viele verschiedene
Werte berechnen muss, ist ein schneller Mikrocontroller (IC 1) mit einem
präzisen Takt, gegeben durch den Quarz Q 1 und die zugehörigen
Lastkapazitäten C 3 und C 4, erforderlich.
Für den Betrieb und die Bedienung im Kfz stehen das LC-Display LCD 1,
die Tasten TA 1 bis TA 6, der Piezo-Signalgeber PZ 1 und eine LED D 2
als Benutzer- Schnittstellen zur Verfügung.
Die Hinterleuchtung des Displays ist über den Widerstand R 4 direkt mit
der +5-V-Betriebsspannung verbunden. Da R 4 eine nicht unwesentliche
Verlustleistung als Wärme abgeben muss, wurde für diesen Widerstand eine
bedrahtete Bauform gewählt. Das Poti R 3 dient zusammen mit dem
Widerstand R 2 der Kontrasteinstellung.
Die Tasten TA 5 und TA 6 sind direkt mit dem Mikrocontroller verbunden,
TA 1 bis TA 4 teilen sich ihre Port-Pins mit dem LC-Display. Im
Normalfall arbeiten die Tasten gegen die internen Pull-up-Widerstände
des Mikrocontrollers. Für die Datenübertragung an das Display werden die
Port-Pins aber kurzzeitig als Ausgänge geschaltet. Um zu verhindern,
dass Datensignale, die für das Display bestimmt sind, von den Tasten
gegen Masse kurzgeschlossen werden, sind die Widerstände R 11 bis R 14
zwischengeschaltet. Diese sind so dimensioniert, dass sich beim
Betätigen der Tasten zusammen mit den internen Pull-up-Widerständen ein
Spannungspegel ergibt, den der Mikrocontroller noch sicher als Low-Pegel
erkennt.
Die Ansteuerung des Piezo-Signalgebers PZ 1 erfolgt über einen Taktgeber
ICM7555 (IC 3), da die internen Timer des Mikrocontrollers mit den
Grundfunktionen des KL 100 bereits ausgelastet sind. Ein positiver
Nebeneffekt dabei ist, dass der ICM7555 und damit auch der
Piezo-Signalgeber direkt mit der +12-V-Betriebsspannung versorgt werden
können. Die Schwelle für den Reset-Eingang liegt bei 0,7 V, so dass
dieser direkt vom Mikrocontroller ansteuerbar ist. So wird eine hohe
Lautstärke ohne zusätzlichen Pegelwandler erreicht. Mit dem Poti R 15
kann man die Signal-Lautstärke einstellen.
Das Tachosignal gelangt über die Widerstände R 6 bis R 8 an zwei
Eingänge des Mikrocontrollers. Der Kondensator C 2 soll Störungen
filtern. Tachosignale mit höheren Amplituden als 5 V werden hinter den
Widerständen durch die internen Schutzdioden des Mikrocontrollers auf 5 V
begrenzt. Die Reihenschaltung aus 3 Widerständen ist aus Gründen der
Sicherheit gewählt. Beim Ausfall (Kurzschluss) einer der Widerstände
verbleibt immer noch die Summe der beiden anderen Widerstände als
Eingangswiderstand des KL 100. Dies schützt zum einen den
Mikrocontroller, falls das Tachosignal durch die internen Schutzdioden
begrenzt wird, zum anderen schützt es die Bordelektrik des Kfz vor dem
Kurzschließen des Tachosignals.
Das Tachosignal gelangt zum einen an einen Input-Capture-Pin, wodurch
der Inhalt vom 16-Bit-Timer des Mikrocontrollers bei jeder fallenden
Signalflanke in einem Register gesichert wird. Damit der KL 100 einen
weiten Bereich von Pulsen pro km abdecken kann, gelangt das Tachosignal
zusätzlich an den Takt-Eingang eines weiteren Timers, der bei hohen
Tachosignalfrequenzen als Vorteiler dient. Das Input- Capture-Register
wird dann nicht mehr nach jeder fallenden Signalflanke gelesen, um den
Mikrocontroller zu entlasten.
Die permanente Versorgungsspannung seitens des Kfz wird über die
Sicherung SI 1 und über die Diode D 1, die als Verpolungsschutz dient,
geleitet. Zusätzlich sind die beiden Widerstände R 19 und R 20 sowie die
Transildiode D 3 eingebaut, die Spannungsimpulse oberhalb der
zulässigen Betriebsspannung abfangen sollen. Beim Betrieb im Kfz wird
der KL 100 über den Transistor T 3 ein- und ausgeschaltet. Dieser
wiederum ist durch die Transistoren T 1 oder T 2 ansteuerbar. T 1
schaltet den KL 100 ein, sobald die geschaltete Spannung des Kfz
anliegt. Über R 37 kann auch der Mikrocontroller die geschaltete
Spannung überwachen. Falls vor dem Ausschalten noch Daten gespeichert
werden müssen, kann der Mikrocontroller das Ausschalten mittels
Transistor T 2 verzögern. Schließlich wird für den Betrieb im Kfz noch
der Spannungsregler IC 4 benötigt, der eine Spannung von 5 V (+Ureg) zur
Verfügung stellt.
Für die Datenloggerfunktion ist ein Flash-Speicher (IC 2) eingebaut. Da
dieses IC nicht mit +5 V arbeitet, liefert ein weiterer Spannungsregler
(IC 5) eine Spannung von +3,3 V. Die Datenleitungen des Flash-Speichers
können direkt mit dem Mikrocontroller verbunden werden, da die Eingänge
spannungsfest bis über 5 V sind und der Mikrocontroller auch die
kleineren Ausgangspegel noch als High- Pegel erkennt.
Für das Auslesen der Daten verfügt der KL 100 über ein USB-Interface,
das in ähnlicher Form auch in vielen anderen ELV-Geräten zum Einsatz
kommt. Beim Betrieb im Kfz wird das USB-Interface nicht versorgt. Die
beiden Dioden D 4 und D 5 verhindern dabei, dass das Interface ungewollt
über die Datenleitungen versorgt wird.
Zur Quellenumschaltung werden im KL 100 die beiden MOSFET-Transistoren T
4 und T 5 benutzt. So wird die jeweils aktive Versorgungsspannung,
anders als bei einer Entkopplung durch Dioden, ohne nennenswerte
Verluste weitergeleitet, vorausgesetzt, es ist jeweils nur eine Quelle
angeschlossen. Nachbau
Der
KL 100 enthält eine Platine, die einseitig sowohl mit SMD-Bauteilen als
auch mit bedrahteten Bauteilen bestückt ist. Der Nachbau wird dadurch
erleichtert, dass die SMD-Bauteile bereits vorbestückt sind. Die
SMD-Bauteile sollten aber dennoch auf sichtbare Bestückungsfehler
geprüft werden.
Bei der weiteren Bestückung dienen das Schaltbild, der Bestückungsdruck
und das Platinenfoto als Hilfe.
Die Bestückung beginnt mit dem Widerstand R 4 , der Transildiode D 3 und
dem Quarz Q 1. Anschließend werden die Elkos C 9, C 12, C 14, C 17 und C
20 eingebaut. Dabei ist auf die korrekte Polarität zu achten. Der
Minuspol ist auf den Elkos markiert.
Es folgen die Tasten TA 1 bis TA 6 und die beiden Potis R 3 und R 15
sowie die beiden Buchsen BU 1 und BU 2 und der Piezo-Signalgeber PZ 1.
Die Stiftleiste für das LC-Display muss beim Einlöten genau senkrecht
stehen. Bei der LED D 2 ist auf die Polung und die Einbauhöhe zu achten.
Der Anodenanschluss ist geringfügig länger. Die LED muss mit einem
Abstand von 18 mm zwischen der LED-Spitze und der Platinenoberfläche
eingebaut werden. Die Gehäuseoberschale kann dabei als Montagehilfe
dienen.
Bevor das Display endgültig montiert wird, sollte man einen kurzen
Funktionstest durchführen. Zuerst sollte das USB-Interface geprüft
werden. Dazu ist das Display nicht erforderlich. Man verbindet den KL
100 mit einem PC und führt die Treiberinstallation durch. Anschließend
trennt man den KL 100 wieder vom PC.
Für den Displaytest sollte der Kontrastregler R 3 in Mittelstellung
eingestellt sein. Jetzt führt man das Display über die Stiftleisten und
kippt es so (von der Grundplatine weg), dass die Stifte eingeklemmt und
damit auch kontaktiert werden. Wird der KL 100 jetzt wieder mit dem PC
verbunden, sollte das Display etwas anzeigen. Wenn der Test erfolgreich
war, ist das Display mit den 4 Schrauben, 4 Abstandshaltern und 4
Muttern zu montieren. Die Schrauben müssen dabei von der Unterseite der
Platine her eingesteckt werden, damit das Gehäuseunterteil später noch
passt. Wenn das Display fixiert ist, wird es mit der Stiftleiste
verlötet. Jetzt werden die Tastkappen auf die Tasten und die Steckachsen
auf die Potis gesteckt. Zuletzt ist die Schaltung in das
Gehäuseoberteil einzusetzen sowie das Gehäuseunterteil aufzuschieben.
Damit ist der KL 100 fertig aufgebaut.Installation
Der
KL 100 ist nicht für den festen Einbau im Kfz vorgesehen, sondern nur
für den Betrieb im Kfz während der Messfahrten. Zum Auslesen des
Datenloggers muss der KL 100 wieder aus dem Kfz entnommen werden.
Geeignete Orte für den Betrieb im Kfz sind also Ablagen, z. B. in der
Mittelkonsole, ein geeigneter Handyhalter oder die Hände des Beifahrers.
Auf jeden Fall dürfen Gerät und Anschlussleitungen nicht den Fahrer
behindern – so muss man Anschlussleitungen z. B. so verlegen, dass sie
niemals in das Pedalwerk, die Lenkung, die Schaltung usw. geraten
können. Auch das Gerät selbst darf sich während der Fahrt nicht von
seinem Platz lösen können, hier empfehlen sich z. B. Klebepads mit
Klettband und besonders die bereits erwähnten Handyhalter, die ja meist
auch quer eingestellt werden können.
Für den Betrieb im Kfz ist eine Anschlussleitung vorzubereiten, die
unter den o. g. Bedingungen bis zum gewünschten Betriebsort des KL 100
reichen muss. Zum Verbinden können die mit dem KL 100 mitgelieferten
Leitungen und Leitungsabzweiger benutzt werden. Um Kurzschlüsse zu
vermeiden, müssen die Leitungen in jedem Fall zuerst mit dem Steckerteil
verbunden werden und erst danach mit der Kfz-Elektrik. Die Zuordnung
der Leitungen erfolgt typischerweise gemäß Tabelle 1. Weitere
Informationen über die Leitungszuordnung finden sich im ersten Teil
dieses Artikels.
Für den Betrieb im Kfz ist eine Anschlussleitung vorzubereiten, die
unter den o. g. Bedingungen bis zum gewünschten Betriebsort des KL 100
reichen muss. Zum Verbinden können die mit dem KL 100 mitgelieferten
Leitungen und Leitungsabzweiger benutzt werden. Um Kurzschlüsse zu
vermeiden, müssen die Leitungen in jedem Fall zuerst mit dem Steckerteil
verbunden werden und erst danach mit der Kfz-Elektrik. Die Zuordnung
der Leitungen erfolgt typischerweise gemäß Tabelle 1. Weitere
Informationen über die Leitungszuordnung finden sich im ersten Teil
dieses Artikels.
Die Installation ist damit abgeschlossen. Zum Betrieb im Kfz ist der KL
100 nun mit dem Steckerteil zu verbinden.
Im nächsten Teil dieses Artikels gehen wir auf die umfangreiche
Inbetriebnahme ein.
|
| Ansicht der fertig bestückten Platine des Kfz-Leistungsmessers mit zugehörigem Bestückungsplan |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Kfz-Leistungsmesser KL 100 – zeigt, was in Ihrem Motor steckt Teil 2/4
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
| weitere Fachbeiträge | Foren | |
Hinterlassen Sie einen Kommentar:



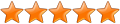









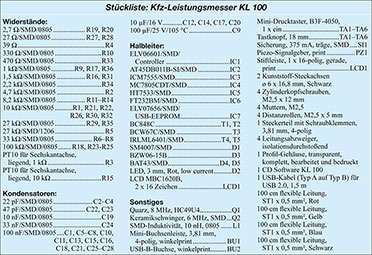
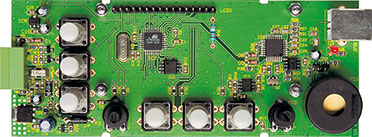

 als Online-Version
als Online-Version als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)



