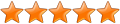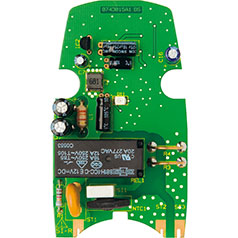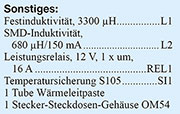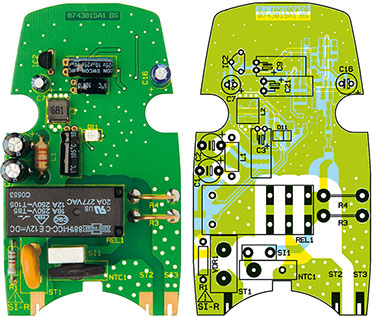230-V-Einschaltstrombegrenzung 3680 VA ESB 54
Aus ELVjournal
04/2007
0 Kommentare
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 230 VAC |
| Stromaufnahme (Stand-by) | 0,002 A |
| Schaltschwelle/Relais | 20 VA |
| Schaltausgang | 16 A |
| Abm. (B x H x T) | 59 x 39 x 134 mm |
Die
Einschaltstrombegrenzung verhindert, dass bei Verbrauchern mit einem
hohen Einschaltstrom, wie z. B. größere Motoren, Netzteile oder
Verstärker mit einem sehr leistungsfähigen Netztransformator, die
Haussicherung für den entsprechenden Leitungskreis anspricht. Dies
geschieht dadurch, dass mittels eines NTC-Widerstandes der Einschalt-
bzw. Anlaufstrom des angeschlossenen Verbrauchers während der
Einschaltphase stark reduziert wird.Gebremste Leistung
Wohl
jeder hat im Haushalt, insbesondere in einem mit etwas älterer
Elektroanlage, schon einmal den Effekt erlebt, dass beim Einschalten
eines leistungsfähigen Elektrogerätes die Netzsicherung auslöst.
Insbesondere Verbraucher mit großen Induktivitäten wie z. B. größere
Motoren und Leistungstrafos können Auslöser sein. Diese Verbraucher
wirken im Einschaltmoment fast wie ein Kurzschluss, der folglich die
zuständige Sicherung auslöst. Obwohl das Gerät z. B. „nur“ 8 A
Stromaufnahme hat, übersteigt der Strombedarf im Einschaltmoment diesen
Wert um ein Vielfaches, so dass die 16-A-Standard-Absicherung
selbstverständlich ihrer angestammten Aufgabe gerecht wird und
abschaltet. Für den normalen Betrieb ist sie völlig ausreichend
dimensioniert, aber eben nicht intelligent genug, den kurzen
Einschaltstromstoß zu „interpretieren“. Unsere Einschaltstrombegrenzung
verhindert dieses sehr wohl funktionsgerechte, aber in diesem Falle eher
lästige Ansprechen der Netzsicherung, indem im Einschaltmoment eine
Strombegrenzung durch einen speziellen, impulsfesten NTCSerienwiderstand
vorgenommen wird.Nach
dieser Phase unterscheidet das einfach zwischen Steckdose und Last zu
schaltende Gerät zwei Zustände bzw. Bereiche, je nach der Höhe der
Scheinleistung des angeschlossenen Verbrauchers:
1.
Die
Scheinleistung beträgt maximal 20 VA („Kleinverbraucher“): In diesem
Fall reduziert sich der Serienwiderstand des NTC kontinuierlich, bis ein
vom Nennstrom des Verbrauchers abhängiger, stationärer Wert erreicht
ist. Der Verbraucher wird in diesem Fall ständig über den NTC-Widerstand
betrieben.
2.
Die Scheinleistung beträgt mehr als 20 VA:
Nach einer Zeitspanne von 0,4 Sek. schaltet ein Relais den Verbraucher
direkt ans Netz und überbrückt den NTC-Widerstand. Dabei spielt die Art
des Verbrauchers keine Rolle, da der Strom durch einen rein ohmschen
Widerstand begrenzt wird, lediglich die Kontaktbelastbarkeit des Relais
mit max. 16 A (3680 VA) ist zu beachten. Wollen wir die Funktion der
Einschaltstrombegrenzung ESB54 etwas näher betrachten.
Wirkungsweise
Mit
einem in Reihe zum Verbraucher geschalteten NTC wird im Einschaltmoment
der Spitzenstrom begrenzt. Der NTC weist im kalten Zustand einen
Widerstandswert von ca. 33 Ω auf. Je mehr Strom durch den NTC fließt,
desto stärker erwärmt er sich, wobei sich sein Widerstandswert
verringert. Um eine übermäßige Erwärmung bzw. eine Zerstörung bei großen
Betriebsströmen zu vermeiden, wird dem NTC kurz nach dem Einschalten
des Verbrauchers ein Relais parallelgeschaltet, über dessen
Schaltkontakt dann der volle Laststrom fließt. Eine Steuerelektronik in
der ESB54 erkennt, ob der Verbraucher ein- bzw. ausgeschaltet wird. Ab
einer Last von ca. 20 Watt wird automatisch das Relais zugeschaltet, das
dann den NTC entlastet. Sobald der Verbraucher ausgeschaltet wird,
fällt auch das Relais wieder ab. Der NTC ist wieder auf Normaltemperatur
abgekühlt und somit für den nächsten Einschaltvorgang bereit. Der
momentane Schaltzustand des Relais wird durch eine LED am Gerät
signalisiert.Schaltung
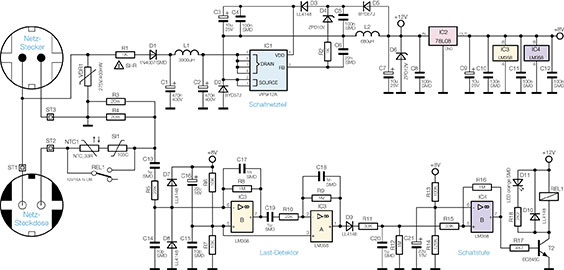
|
| Bild 1: Schaltbild der Einschaltstrombegrenzung |
Die
Spannungsversorgung für die Auswerte- und Steuerelektronik wird mit
einem Schaltnetzteil gewonnen, dessen Hauptbestandteil der
SMPS-Controller (Switch Mode Power Supply) IC 1 ist. Die
230-V-Eingangsspannung gelangt über den Widerstand R 1, D 1 und L 1 auf
den Drain-Anschluss von IC 1. Weitere wichtige Bestandteile dieses
Step-down-Wandlers sind die Speicherspule L 2 und die Diode D 2. Im
Prinzip arbeitet dieser Wandler wie jeder „normale“ Step-down-Wandler
auch. Kurz gesagt wird der interne MOSFET von IC 1 so lange
durchgeschaltet, bis sich am Kondensator C 7 eine Spannung von 12 V
einstellt. Der Schaltregler IC 1 arbeitet mit einer Taktfrequenz von ca.
60 kHz. Über den Feedback-Anschluss (Pin 3) von IC 1 wird die
Ausgangsspannung gemessen, und das Puls-Pause-Verhältnis der
Taktfrequenz des internen MOSFETs so lange nachgeregelt, bis die
Ausgangsspannung (12 V) konstant ist. Der VDR 1 schützt den Schaltregler
vor Überspannungsspitzen aus dem Netz. Die so gewonnene
12-V-Betriebsspannung wird für das Relais REL 1 benötigt. Die
Auswerteelektronik benötigt eine stabile Spannung von 8 V, die mit dem
Spannungsregler IC 2 stabilisiert wird. Wie
schon erwähnt, wird der Laststrom mit den beiden Shunt- Widerständen R 3
und R 4 gemessen. Die Wechselspannung über diesen Widerständen ist
proportional zum fließenden Strom, jedoch relativ klein. Die Verstärkung
erfolgt mit den beiden Operationsverstärkern IC 3 A und IC 3 B. Der
Arbeitspunkt für die beiden Verstärkerstufen wird mit dem
Spannungsteiler R 6 und R 7 auf 4 V festgelegt. Die beiden Dioden D 7
und D 8 schützen den OPEingang vor Spannungsspitzen. Da es sich um
Wechselspannung handelt, sind die Koppelkondensatoren C 13 und C 19
notwendig. Der Verstärkungsfaktor jeder OP-Stufe beträgt 45,45, wodurch
sich ein Gesamtverstärkungsfaktor von 2066 (45,45 x 45,45) ergibt. Das
verstärkte Wechselspannungssignal wird nun mit der Diode D 9
gleichgerichtet und mit C 20 gesiebt. Der nachfolgende Komparator IC 4
wertet diese Spannung aus und schaltet ab einer definierten Spannung den
Ausgang auf High-Pegel, wodurch der Transistor T 2 das Relais REL 1
einschaltet. Dieses Relais überbrückt dann den im Lastzweig liegenden
NTC-Widerstand. Wird der angeschlossene Verbraucher wieder
ausgeschaltet, sinkt die Spannung über den beiden Shunt-Widerständen,
und das Relais fällt wieder ab. Nachbau
Zum Nachbau ist folgender Sicherheitshinweis zu beachten:Achtung!
Aufgrund
der im Gerät frei geführten Netzspannung dürfen Aufbau und
Inbetriebnahme ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden, die
aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen
Sicherheits- und VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. Außerdem
ist bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät, z. B. bei der Reparatur, ein
Netz-Trenntransformator zu verwenden.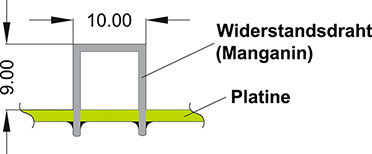
|
| Bild 2: Shunt-Widerstände |
Der
NTC-Widerstand und die Temperatursicherung werden thermisch gekoppelt
montiert. Hier werden beide Bauteile so eingebaut und verlötet, dass sie
auf gleicher Höhe stehen und sich möglichst großflächig berühren. Zur
besseren Wärmeübertragung wird zwischen beiden Bauteilen etwas
Wärmeleitpaste aufgetragen. Zum Schluss wird das Relais bestückt und
verlötet. Gehäuseeinbau und Endmontage
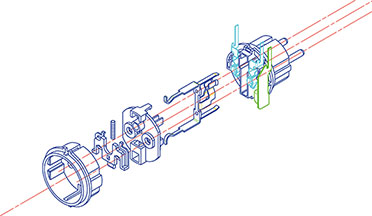
|
| Bild 3: Zusammenbau des Steckdoseneinsatzes |
Inbetriebnahme
Bei
der Inbetriebnahme ist zu beachten, dass zunächst die
Einschaltstrombegrenzung in eine Netzsteckdose zu stecken und danach
erst die Last anzuschließen ist. Damit ist sichergestellt, dass die
Einschaltoptimierung bereits komplett betriebsbereit ist, wenn der
Verbraucher zugeschaltet wird.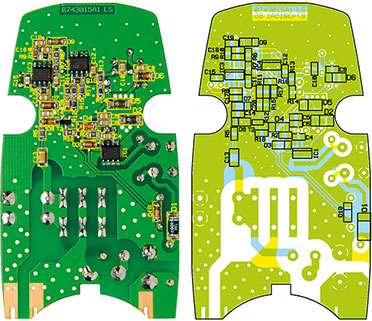
|
| Ansicht
der fertig bestückten Platine der Einschaltstrombegrenzung mit
zugehörigem Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von
der Lötseite |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- 230-V-Einschaltstrombegrenzung 3680 VA ESB 54
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo





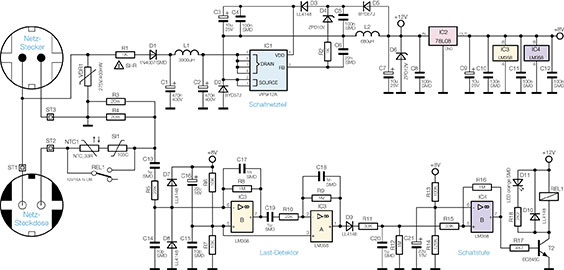
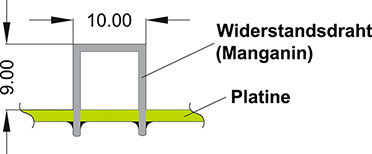
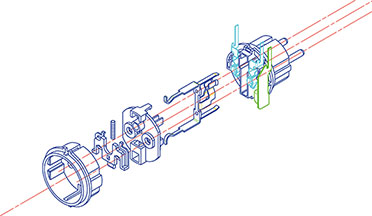
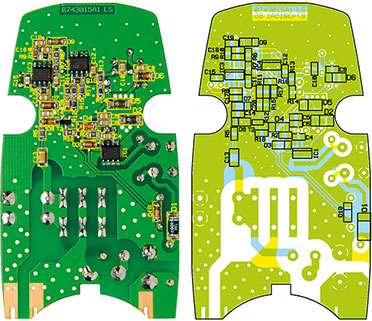
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)