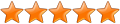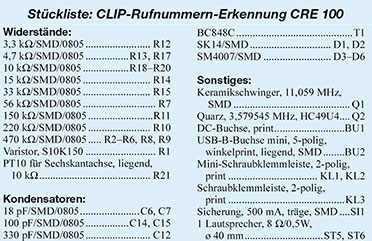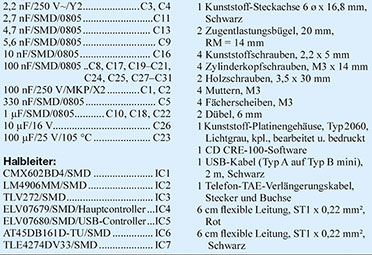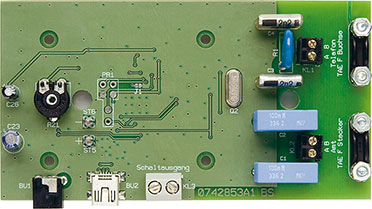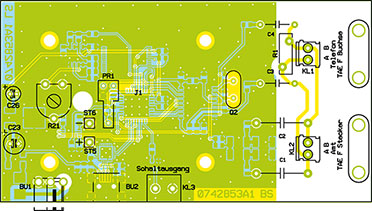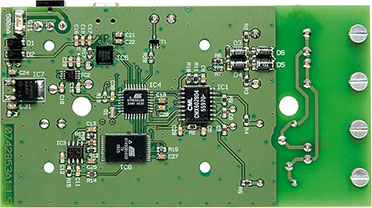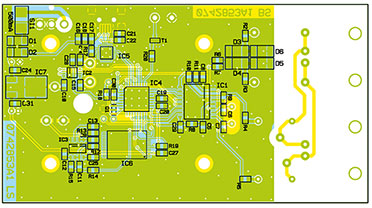CLIP-Rufnummern-Erkennung CRE 100 - Der Rufnummern-Detektiv warnt oder macht gute Laune
Aus ELVjournal
04/2007
0 Kommentare
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 6–18 VDC |
| DC-Versorgungsanschluss | Hohlstecker 3,5/1,3 mm |
| Max. Stromaufnahme | 500 mA bei 8 Ω Lautsprecherimpedanz |
| Max. Ausgangsleistung | 390 mW bei 8 Ω Lautsprecherimpedanz |
| Max. Sound-Speicherkapazität | 90 Sek. |
| Open-Collector-Ausgang | Umax = 30 V |
| Abmessungen (B x H x T) | 115 x 65 x 28 mm |
Erkennen
Sie schon am Klingelton, wer anruft! Dieses Komfortmerkmal modernster
Handys kann man mit der CRE 100 via TAE an jedem analogen
Telefonanschluss und somit unabhängig vom verwendeten Telefon
realisieren. Die CRE 100 kann bis zu acht verschiedene Telefonnummern
speichern und diese mit der Telefonnummer des Anrufers vergleichen. Gibt
es eine Übereinstimmung, spielt das Gerät einen zuvor zugeordneten
Soundfile ab. Insgesamt steht ein Soundspeicher für 90 Sekunden
Abspiellänge zur Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit, externe
Komponenten wie Relais oder LEDs über einen universellen
Open-Collector-Ausgang zu schalten. Die Konfiguration erfolgt via USB
über ein mitgeliefertes Windows-Programm, und vom Rechner stammen auch
die Soundfiles.Big Ben: Schwiegermutter ruft an!
Wie
das jeder für sich empfindet, sei jedem selbst überlassen, aber in
vielen Fällen ist es wirklich sehr nützlich, wenn man schon anhand des
„Klingeltons“ identifizieren kann, wer anruft, um sich darauf einstellen
zu können, eventuell sogar gar nicht erst abzunehmen (Thema „Stalking“)
usw. Bei modernen Handys und auch gut ausgestatteten Festnetztelefonen
kennt man die Zuordnung zwischen Anrufernummer und einem entsprechenden
Display-Text („Chef ruft“) schon einige Zeit. Modernste Handys erlauben
es auch, Anrufern bestimmte Klingeltöne oder sogar beliebige Soundfiles
zuzuordnen. Und genau dies realisiert die CRE 100 für Ihren normalen
Analog-Telefonanschluss! Das kleine Gerät wird einfach zwischen
TAE-Anschlussdose und das Telefon geschaltet und benötigt nur noch ein
Steckernetzteil zur Spannungsversorgung. Der Telefonanschluss wird durch
das Zwischenschalten in keiner Weise eingeschränkt – die CRE 100 „hört“
gewissermaßen nur mit, wird durch die Rufspannung aktiviert und
identifiziert die Rufnummer des Anrufers (CLIP-Funktion).CLIP?
Die
Abkürzung CLIP steht für Calling Line Identification Presentation. Dies
ist ein Leistungsmerkmal für ankommende Rufe, bei dem die Rufnummer des
rufenden Teilnehmers übermittelt wird. Dafür wird ein digitales Signal
nach V.23-Norm mittels Frequenz-Shift-Keying (FSK) verwendet. Die Daten
werden zwischen dem ersten und zweiten Rufsignal (Klingeln) übertragen.Wie geht das?
Die
CRE 100 verfügt über ein Spezial- IC, das diese Daten herausfiltern und
decodieren kann. Der Rest ist einfach – ein Mikrocontroller vergleicht
die decodierten Daten mit den im EEPROM des Mikrocontrollers abgelegten
Rufnummern. Findet sich hier eine Übereinstimmung, erfolgt die Ausgabe
des abgespeicherten und zuvor am PC zugeordneten Soundfiles über einen
kleinen Lautsprecher. Für bestimmte Anwendungen, etwa in lauter Umgebung
oder für Hörbehinderte, ist es möglich, eine oder mehrere Anrufnummern
einem Schaltausgang zuzuordnen, so dass dieser etwa ein Lichtsignal oder
eine Außenklingel ansteuern kann. So weiß man auch unter o. g.
Umständen sofort, dass jemand aus dem gespeicherten Personenkreis von
max. 8 Rufnummern anruft und nicht irgendwer sonst. Ein Blick auf das
Display des (CLIP-fähigen) Telefons sagt dann auch, wer konkret aus
diesem Kreis anruft. Zusammen mit dem Gerät bzw. Bausatz wird eine
Windows-Software ausgeliefert, über die man das Gerät sehr einfach
konfi- gurieren kann. Über diese Software ist es möglich, auch beliebige
(allerdings in ein bestimmtes Format zu bringende) Soundfiles im
WAV-Format, die auf dem PC gespeichert sind, den einzelnen Rufnummern
zuzuordnen und diese auf die CRE 100 zu übertragen. Letzteres erfolgt
über die heute allgegenwärtige USB-Verbindung, die auch die
Spannungsversorgung der CRE 100 übernimmt, solange sie am PC
angeschlossen ist. Sind die Konfigurations- und Sounddaten übertragen,
kann man die CRE 100 vom PC trennen und an ihrem Einsatzort
installieren. Dort erfolgt die Spannungsversorgung über ein externes
Netzteil. Die Daten gehen nach der Trennung von der Stromversorgung
nicht verloren, da sie ausfallsicher in einem Flash-Speicher liegen.
Wollen wir uns zunächst einmal mit der Software, der Installation und
Konfiguration des Gerätes befassen.Installation und Bedienung
Zuerst
sind der USB-Treiber und die Software auf dem PC zu installieren.
Nutzer des Betriebssystems Windows XP und Windows 2000 können die CRE
100 zur ersten Inbetriebnahme an einem freien USB-Port des Computers
anschließen. Der PC erkennt die neu angeschlossene Hardware und verlangt
nach kurzer Zeit einen USB-Treiber. Dieser Treiber (CRE100.inf)
befindet sich auf der mitgelieferten Programm-CD im Ordner
„ELV_CRE100_Drivers“. Die zwischenzeitliche Warnung, dass es sich um
einen unsignierten Treiber ohne Windows- Logo handelt, ist dabei zu
ignorieren.Extratour für Windows 98 SE/Me
Unter
Windows 98 SE bzw. Me ist vor dem Anschließen der CRE 100 die Datei
„Preinstaller.exe“ auszuführen. Sie befindet sich ebenfalls im Ordner
„ELV_CRE100_ Drivers“. Anschließend kann die CRE 100 mit dem PC
verbunden werden. Nach der Installation des Treibers installiert man die
ebenfalls auf der CD befindliche PC-Software. Um die Software optimal
bedienen zu können, ist eine Bildschirmauflösung von mindestens 1024 x
768 Bildpunkten notwendig.Programmstart
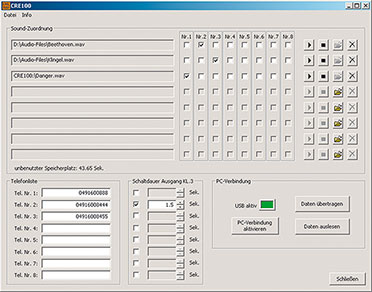
|
| Bild 1: Das Programmfenster des Konfigurationsprogramms |
Nach
dem Programmstart öffnet sich das Dialogfenster (Abbildung 1). Über
dieses Fenster werden alle Einstellungen am Gerät vorgenommen, es ist in
mehrere Abschnitte unterteilt, die wir im Folgenden erläutern. Um die
Verbindung zwischen dem PC und der CRE 100 herzustellen, ist zunächst
der Button „PC-Verbindung aktivieren“ zu drücken. Eine aktive
USB-Verbindung erkennt man daran, dass die Farbfläche neben der
Beschriftung „USB aktiv“ von Rot nach Grün wechselt. Ein nochmaliger
Druck auf den Button trennt die USB-Verbindung wieder. Mit dem Button
„Daten auslesen“ besteht die Möglichkeit, die aktuellen Einstellungen
aus der CRE 100 auszulesen. Hinweis: Während die PC-Verbindung aktiviert ist, ist die Rufnummern-Erkennung deaktiviert.
Sound-Zuordnung
In
diesem Abschnitt des Programmfensters wird festgelegt, welcher Sound
bei welcher erkannten Telefonnummer starten soll. Um eine WAV-Datei auf
die CRE 100 zu übertragen, ist zunächst über den Ordner-Button die
Audiodatei auf dem PC auszuwählen. Nach erfolgreicher Auswahl erscheint
in dem Textfeld auf der linken Seite der zugehörige Datei-Pfad. Mit dem
Play-Button ist eine Wiedergabe des Soundfiles zur Kontrolle möglich,
der Stop-Button beendet die Wiedergabe. Damit die Sound-Dateien zur CRE
100 übertragen werden können, müssen diese in einem bestimmten Format
auf dem PC vorliegen:
Format: WAV (PCM)
Samplingrate: 22,050 kHz
Auflösung: 8 Bit
Anzahl an Kanälen: 1 (Mono)
Nur
unter diesen Bedingungen ist es der CRE 100 möglich, die Sounds
auszugeben. Um eine solche Sound-Datei zu erstellen, kann man z. B. den
im Windows- Betriebssystem vorhandenen Audiorecorder einsetzen. Außerdem
gibt es im Internet diverse kostenfreie Programme, die eine Umwandlung
selbst von anderen Audio-Formaten in das erforderliche Format
ermöglichen oder die Lautstärke des Soundfiles verändern. Im nächsten
Schritt erfolgt die Festlegung, welche Telefonnummer mit dem Sound
verknüpft werden soll, dazu wird das jeweilige Häkchen neben dem
Textfeld gesetzt. In Abbildung 1 kann man z. B. erkennen, dass der
Rufnummer 04916008444 der Sound „Beethoven.wav“ zugeordnet ist. Eine
WAV-Datei ist auch für mehrere Telefonnummern einsetzbar. Dafür sind
einfach die entsprechenden Häkchen neben dem Textfeld zu setzen. Um
einen Sound aus der Zuordnung zu entfernen, muss der Button „Sound
Löschen“ betätigt werden. Beginnt der Pfad eines Soundfiles mit
„CRE100:\\...“, so befindet sich dieser im Datenflash der CRE 100. Im
unteren Bereich des Abschnitts erscheint der unbenutzte Speicherplatz in
Sekunden. Diese Anzeige wird nach jeder Änderung automatisch angepasst
und liefert so schnell und präzise die noch zur Verfügung stehende Zeit.
Telefonliste
In
diesem Bereich sind die Rufnummern einzutragen, auf die die
CLIP-Rufnummern-Erkennung reagieren soll. Die Rufnummer ist einfach
fortlaufend, ohne Zwischenräume, Trennstriche usw. in ein leeres Feld
einzutragen. Um eine Rufnummer zu entfernen, markiert man sie mit der
Maus und löscht sie mit der „Entf“- Taste auf der Tastatur.Schaltausgang definieren
Neben
der Telefonliste befindet sich der Bereich zum Einstellen des
Schaltausgangs. Mit dem Setzen des Häkchens neben der Rufnummer wird nun
bei Erkennung der Rufnummer der Open-Collector-Ausgang an Klemme KL 3
durchgeschaltet. Dabei kann man die Zeitdauer angeben, wie lange der
Ausgang durchgeschaltet bleiben soll. Die Zeit ist dabei auf maximal 5
Sek. in 0,1-Sek.-Schritten einstellbar.Daten übertragen
Sind
alle Einstellungen vorgenommen, kann die Konfiguration mit dem Button
„Daten übertragen“ auf der CRE 100 gespeichert werden. Nachdem alle
Daten übertragen sind, öffnet sich ein Hinweisfenster zur Bestätigung.
Die Datenübertragung kann je nach Datenmenge mehrere Minuten dauern.Schaltungsbeschreibung
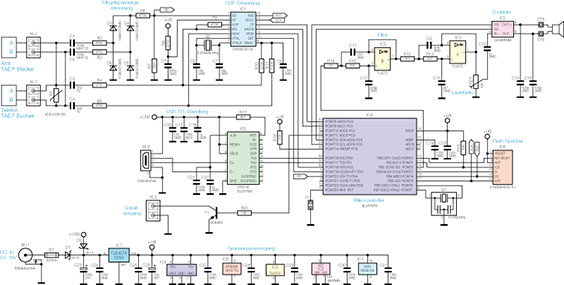
|
| Bild 2: Das Schaltbild der CRE100 |
Die
Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller und dem Flash-Speicher
erfolgt über die SPI-Schnittstelle (Serial Peripheral Interface). Dabei
ist der Mikrocontroller der Master und der Flash- Speicher der Slave.
Über die Chip-Select- Leitung (Pin 11 von IC 6) kann der Mikrocontroller
den Flash-Speicher ansprechen und seine Daten von MOSI (Master out
Slave in) nach SI (Slave in) transportieren. Das Auslesen der Sounddaten
erfolgt von SO (Slave out) nach MISO (Master in Slave out). Der für
beide Richtungen benötigte Takt wird vom Master an der SCK-Leitung
erzeugt (Serial Clock). Über Pin 12 kann der Mikrocontroller sofort
erkennen, ob der Flash-Speicher im Moment beschäftigt ist oder neue
Befehle von Controller empfangen kann. Der Widerstand R 19 ist als
Pull-up-Widerstand eingesetzt. Die Datenverbindung zwischen der
PCSoftware und der CRE 100 wird über den USB-TTL-Wandler IC 5
hergestellt. Dazu besteht zwischen dem Mikrocontroller IC 4 und dem IC 5
eine serielle Datenverbindung via „RxD“ und „TxD“. Die Kondensatoren C
16 bis C 18 sowie C 21 und C 22 dienen zur Entstörung und Stabilisierung
der Versorgungsspannung +USB. Ein definierter Reset des Wandlers nach
dem Anschließen an einem USB-Port wird durch den auf +USB gelegten
Widerstand R 17 am Reset- Pin 9 erreicht. Kommen wir nun zum
eigentlichen Herzstück der CRE 100, der CLIP-Erkennung. Wie schon
eingangs erwähnt, werden die CLIP-Daten als FSK-moduliertes Signal
zwischen dem ersten und zweiten Klingeln übertragen. Das IC 1 vom Typ
CMX602B demoduliert diese Daten und gibt sie über die Signalleitung RxD
zum Pin 16 des Mikrocontrollers aus. Der CMX602B wird mit dem Quarz Q 2
betrieben, der den Systemtakt auf 3,579 MHz stabilisiert. Die Anbindung
an das Telefonnetz erfolgt über die Klemmen KL 1 und KL 2. Der
eingesetzte Varistor R 1 schützt die Schaltung vor Überspannungen aus
eventuellen Blitzeinschlägen oder Störungen im Telefonnetz. Mit den
Kondensatoren C 1 bis C 4 wird der Gleichspannungsanteil abgeblockt und
die Widerstände R 2 bis R 5 dienen als Schutzwiderstände. Das Klingeln
eines Telefons wird durch ein die Telefon-Gleichspannung überlagerndes
Wechselspannungssignal ausgelöst. Um dieses Wechselspannungssignal zu
detektieren, erfolgt zunächst eine Gleichrichtung mit einem
Brückengleichrichter, bestehend aus den Dioden D 3 bis D 6. Damit das so
gleichgerichtete Spannungssignal auch am Pin 3 (RD) vom CMX602B
auswertbar ist, ist es noch mit dem Spannungsteiler aus R 6 und R 7 auf
einen für die Elektronik ungefährlichen Spannungspegel zu bringen.
Gleichzeitig wird dieses Signal über die Signalleitung RD zum Pin 2 des
Mikrocontrollers gegeben. Nach dem Klingeln werden die Pins 10 und 11
des IC 1 so vom Mikrocontroller angesteuert, dass der CMX602B sich im
Modus zur FSK-Demodulierung befindet. Das
nachfolgende Signal aus FSKmodulierten CLIP-Daten gelangt über die
Kondensatoren C 3 und C 4 und die Widerstände R 4 und R 5 an die Pins 6
und 7 des CMX602B. An diesen Pins befinden sich die Eingänge eines
On-Chip-Operationsverstärkers. Ab hier beginnt der CMX602B mit der
Demodulation des Datensignals. Mit einem vom Mikrocontroller IC 4 über
die SCK-Leitung zur Verfügung gestellten Taktsignal werden die
demodulierten CLIPDaten vom CMX602B übermittelt. Damit nach dem Erkennen
einer Telefonnummer die CRE 100 einen Klingelton abspielen kann, werden
die Sounddaten aus dem Flash-Speicher ausgelesen und am Pin 14 des
Mikrocontrollers als PWM-Signal (Pulsweitenmodulation) ausgegeben. Um
aus diesem digitalen Signal wieder ein analoges Audio-Signal zu
erzeugen, erfolgt die Einspeisung des PWM-Signals in das nachfolgende
Filter. Das gesamte Filter um IC 3 A und B ist ein Butterworth-Filter 4.
Ordnung mit einer Grenzfrequenz von ca. 8 kHz. Das nun am Pin 1 von IC 3
A anliegende analoge Audio-Signal wird über das Potentiometer R 21, das
zur Lautstärkeeinstellung dient, und den Kondensator C 10 auf den
Eingang der Endstufe geführt. Der Kondensator C 10 befreit das Audio-
Signal vom Gleichspannungsanteil. Die verwendete Endstufe vom Typ LM4906
ist ein Audio-Verstärker, der komplett ohne externe Bauteile auskommt.
Die beiden Kondensatoren C 14 und C 15 sind eingesetzt, um eventuelle
hochfrequente Störspannungen zu eliminieren. Durch einen Low-Pegel an
der Steuerleitung SD kann die Endstufe in den Shutdown-Mode gebracht
werden. In dieser Einstellung ist der Ausgang abgeschaltet und die
Stromaufnahme des Verstärkers wird auf ca. 0,1 μA gesenkt. Die Steuerung
des Shutdown- Mode übernimmt der Mikrocontroller. Mit der anderen
Steuerleitung (GS) ist es möglich, zwei Verstärkungsfaktoren
einzustellen. Bei einem High-Pegel ist die Verstärkung auf 12 dB (4 V/V)
eingestellt, mit anliegendem Low-Pegel sind es 6 dB (2 V/V). Bei der
CRE 100 sind die 12 dB fest eingestellt. An den beiden Lötstiftösen ST 5
und ST 6 wird der Lautsprecher angeschlossen. Kommen wir nun zum Aufbau
des Gerätes. Nachbau
Der
Aufbau des Gerätes gestaltet sich unkompliziert, da alle SMD-Bauteile
bereits vorbestückt sind. Dies erspart den Umgang mit den mitunter nicht
leicht zu handhabenden SMD-Bauteilen. Dennoch ist die Bestückung wie
üblich auf Bestückungsfehler, Lötzinnbrücken und vergessene Lötstellen
zu prüfen. Die Bestückung der restlichen Bauelemente erfolgt in
gewohnter Weise anhand des Bestückungsplans, der Stückliste und unter
Zuhilfenahme der Platinenfotos. Dabei ist auf die richtige Polarität der
beiden Elkos C 23 und C 26 zu achten. Ebenso sollten die Buchse (BU 1)
und die Klemmen (KL 1 bis KL 3) plan aufgesetzt und sauber ausgerichtet
angelötet werden. Die beiden Zugentlastungsbügel werden jeweils mit zwei
Schrauben M3 x 14 mm, zugehörigen Muttern und Fächerscheiben befestigt,
dazu sind die Schrauben von der Lötseite durch die entsprechenden
Bohrungen zu führen, die Zugentlastung von der Bestückungsseite her auf
die Schrauben zu setzen und mit Fächerscheibe und Mutter locker zu
befestigen. Die endgültige Montage erfolgt, nachdem die
Anschlussleitungen durchgeführt und an die Platine angelötet sind. Zum
Schluss wird R 21 mit der Poti-Achse versehen. Damit ist die Bestückung
der Platine abgeschlossen, sie ist jetzt nochmals auf Bestückungsfehler,
vergessene Bauelemente und Lötfehler zu kontrollieren.Anschlusskabel vorbereiten
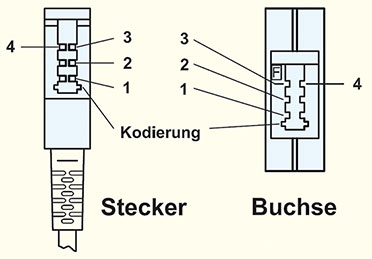
|
| Bild 3: Die Anschlussbeschaltung von TAE-Stecker und TAE-Buchse |
Inbetriebnahme
Hat
man die CRE 100, wie im Abschnitt „Installation und Bedienung“
beschrieben, konfiguriert, kann das Gerät nun in Betrieb gehen. Wie
gesagt, für den Betrieb am PC ist kein Netzteilanschluss notwendig, hier
wird das Gerät per USB versorgt. Anschließend erfolgt der Anschluss an
das Telefonnetz. Zunächst ist der TAE-Stecker des Telefons aus der
zugehörigen TAE-Dose zu ziehen und in die TAE-Buchse der CRE 100 zu
stecken. Dann steckt man den TAE-Stecker der CRE 100 in die
TAE-Anschlussdose. Für die Inbetriebnahme ist die CRE 100 mit einer
Gleichspannung im Bereich von 6 V bis 18 V zu versorgen. Zur
Gewährleistung der elektrischen Sicherheit muss es sich bei der
speisenden Quelle um eine Sicherheits-Schutzkleinspannung handeln.
Außerdem muss es sich um eine Quelle begrenzter Leistung handeln, die
nicht mehr als 15 VA liefern kann. Üblicherweise werden beide
Forderungen von einfachen 12-V-Steckernetzteilen mit bis zu 500 mA
Strombelastbarkeit erfüllt. Schaltnetzteile sind als Spannungsversorgung
für diese Schaltung nicht zu verwenden, da es dabei zu Störungen der
Sprachübertragung kommen kann. Ein kurzer Anruftest von den
gespeicherten Telefonnummern liefert nun die Bestätigung, dass das Gerät
funktioniert und ab jetzt seinen Dienst verrichten kann.Achtung!
Schließen
Sie die Telefonleitung erst an, wenn alle Löt- und Montagearbeiten
abgeschlossen sind und das Gehäuse verschlossen ist. Auf der
Telefonleitung und damit an der CRE 100 können hohe Signal- und
Überspannungen auftreten, die bei Berühren spannungsführender Teile
Gesundheitsschäden hervorrufen können!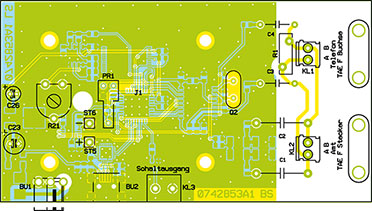
|
| Ansicht der fertig bestückten Platine der CRE 100 von der Bestückungsseite |
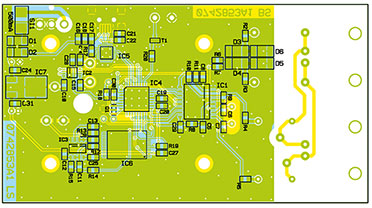
|
| Ansicht der fertig bestückten Platine der CRE 100 von der Lötseite |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (6 Seiten)
als PDF (6 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- CLIP-Rufnummern-Erkennung CRE 100 - Der Rufnummern-Detektiv warnt oder macht gute Laune
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo





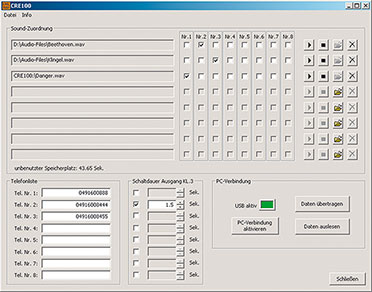
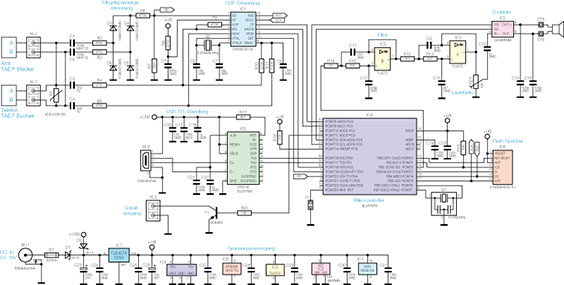
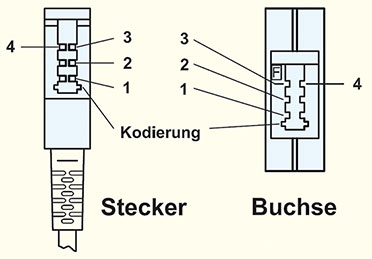
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (6 Seiten)
als PDF (6 Seiten)