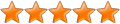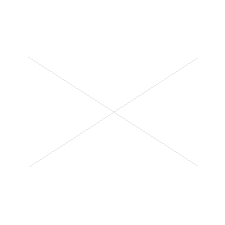Eine für alle – universelle CAN-Bus-Alarmanlage
Aus ELVjournal
04/2007
0 Kommentare
Weg vom Kabelbaum
Anfang,
der 80er Jahre, als die Elektronik in unsere Autos einzuziehen begann,
hat man sich beim Auto-Ausrüster Bosch bereits Gedanken gemacht, wie
denn zukünftig der nun ausufernde Verkabelungsaufwand (mit der
entsprechenden Gewichtszunahme) im Fahrzeug wenigstens begrenzt, wenn
nicht gesenkt werden könnte. Denn immer mehr Steuergeräte, immer mehr
Funktionen, Mehrfachnutzungen von Geräten und der in diesen Jahren
„ausbrechende“ Innovationsdruck ließen den weitblickenden
Fahrzeugelektroniker rechtzeitig erkennen, dass man hier zu einer neuen
Lösung kommen müsste. So entstand 1983 der Gedanke, ein Bus-System mit
nur zwei Leitungen einzuführen, das alle Steuerbefehle in einem
bestimmten Regime zwischen den einzelnen Geräten transportieren sollte.
Das spart erheblichen Verkabelungsaufwand, muss doch jedes Gerät am Bus
nur noch mit dem Bordnetz und seinen Aktoren verbunden werden. 1991 war
es dann soweit, als erstes Auto erhielt die damals mit Elektronik reich
bestückte Mercedes-S-Klasse ein CAN-Bus-System, hier waren immerhin bis
zu 50 kleine Minicomputer in den vielen Steuergeräten verbaut. Das
Bus-System machte nun auch die Installation so komplexer Geräte wie
eines integrierten Navigationsgerätes möglich. Dabei befinden sich
Navigationsrechner und Radio-Steuergerät im Kofferraum, Bildschirm und
Bedieneinheit im Cockpit. Über den Zweidraht- Bus kommunizieren nicht
nur diese Geräte miteinander, auch die relevanten Fahrzeug-
Bewegungsdaten wie Geschwindigkeit, Radumdrehungszahl, Vor- und
Rückwärtsfahrt werden aus dem Bus gelesen. Ohne diese wären die
Navigationsgeräte der ersten Generation zu ungenau gewesen, damals war
das amerikanische GPS-System noch nicht für die zivile Nutzung
zugänglich mit der heute hohen Genauigkeit.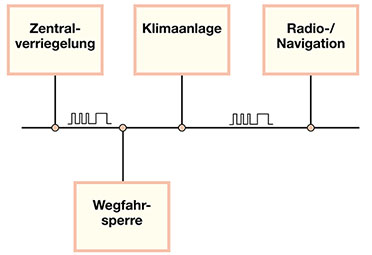
|
| Bild 1: Die Bus-Topologie des CAN-Bus-Systems, hier im Beispiel als Komfort-Bus im Kfz |
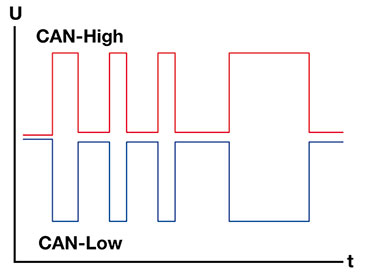
|
| Bild
2: Die Datenübertragung auf dem CAN-Bus erfolgt differentiell – so
wirken sich Störeinkopplungen praktisch nicht auf die Auswertbarkeit des
Signals aus. |
Nachrüsten schwieriger
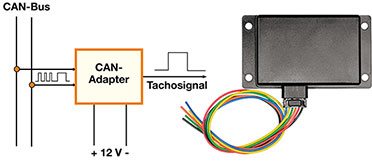
|
| Bild 3: CAN-Adapter koppeln u. a. gezielt das Tachosignal aus und stellen es zur Auswertung zur Verfügung. (Foto: OSMA GmbH) |
Ran an den Bus!
Will
man nun ein Gerät direkt am Bus platzieren, das auch aktiv an diesem
arbeitet, ist schon etwas mehr Aufwand erforderlich – ein solches
Vorhaben endete bisher regelmäßig in der Markenwerkstatt, mit (teurem)
Original-Zubehör, da es auf dem freien Zubehörmarkt kaum CAN-Bus- Geräte
gab. Im Fall unserer vorzustellenden Alarmanlage muss diese aktiv mit
mehreren Geräten am Bus kommunizieren, z. B. der Zent ralverriegelung,
der Wegfahrsperre, der Hupen- und Lichtsteuerung. Der Vorteil: Man spart
sehr viel Verkabelungsaufwand, der Einbau kann tatsächlich in wenigen
Minuten erledigt werden. Die „Hauptarbeit“ hat man zuvor am Computer bei
der Konfiguration der Alarmanlage zu verrichten. Wir wollen am Beispiel
der intelligenten CAN-Bus-Alarmanlage „Can Bus Line“ von Tobé einmal
betrachten, wie der Einbau und die Konfiguration eines solchen Gerätes
erfolgen.Can Bus Line – eine für alle

|
| Bild 4: Die Can-Bus-Line-Alarmanlage mit Zubehör und PC-Interface |
Zur
Signalisierung des Zustands der Anlage dient eine extern
anzuschließende und abgesetzt im Cockpit installierbare Leuchtdiode.
Einmal installiert, überwacht die Alarmanlage das gesamte Schließsystem
des Autos inklusive vorhandener Haubenund Klappenkontakte. Ein
unschätzbarer Vorzug dieser Anlage gegenüber vielen anderen Anlagen ist
der, dass hier durch einen Aufbrecher nicht die Schlosselektronik
„überwunden“ werden kann. Dies ist bei anderen Anlagen, die dem Fahrzeug
quasi nur „aufgepfropft“ werden, durchaus möglich. Bei der
CAN-Bus-Anlage wird jedoch in jedem Fall eine Störungsmeldung aktiviert.
Die Bedienung erfolgt allein über die serienmäßige
Original-Fernbedienung des Autos, die Bestätigung der Aktivierung/
Deaktivierung erfolgt über die Status-LED, die Blinker und einen
internen akustischen Signalgeber. Das clevere Gerät enthält einen
Alarmspeicher, der nach einem Alarm die Auslöseursache speichert. So
kann man schnell ermitteln, wo und wie ein Einbruchsversuch
stattgefunden hat – oder auch einen defekten Sensor finden. Falls der
Auto-Handsender einmal defekt bzw. dessen Batterie leer ist, kann man
die Anlage mit dem Zündschlüssel via PINCode aktivieren/deaktivieren.
Für Taxifahrer gibt es für einige Modelle die Option, einen
Überfall-Alarm bei fahrendem Auto auszulösen. Für welche Automodelle die
Anlage geeignet ist, findet man detailliert im ELV-Internet- Angebot
zur „Can Bus Line“. Hier ist quasi alles von Audi bis VW vertreten. Aufbau und Konfiguration

|
| Bild 5: Ein USB-Seriell-Wandler macht das PC-Interface auch an PCs nutzbar, die allein über USB-Ports verfügen. |
Erstens: Sitzung am PC
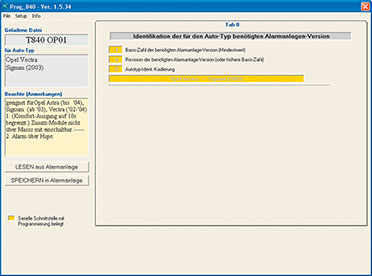
|
| Bild 6: Die einfach zu übersehende Programmoberfläche von „ProDam“, hier ist die Parameterdatei für den Opel schon geladen. |
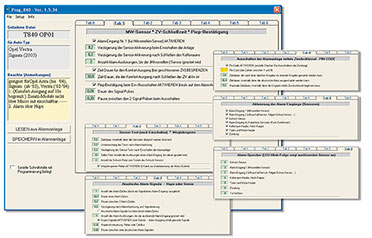
|
| Bild
7: Über die erweiterte Parametereinstellung ergeben sich enorme
Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration der eigenen Alarmanlage. |
Zweitens: rein ins Auto!

|
| Bild 8: Die ausführliche und bebilderte Einbauanleitung macht das Finden der Anschlüsse im Auto leicht. |
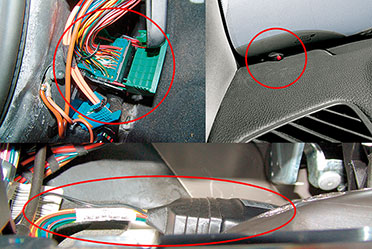
|
| Bild
9: Schnell installiert – der Zentralstecker ist schnell gefunden und
angeschlossen (oben links), die Kontroll-LED platziert (oben rechts) und
die Anlage selbst findet ihren Platz unterhalb des Sicherungsträgers
(unten). Achtung! Den Zentralstecker wieder zuklappen, sonst blockiert
die Wegfahrsperre den Motorstart! |
Drittens: funktioniert!
Ein
kurzer Test zeigt, dass alles funktioniert – nun ist der Wagen sicherer
vor Langfingern! Das Einbaubeispiel zeigt anschaulich, mit wie wenig
Aufwand man ein Gerät am CAN-Bus installieren kann, wir sind überzeugt,
dass dies erst der Anfang dieser interessanten Nachrüsttechnik ist!Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Eine für alle – universelle CAN-Bus-Alarmanlage
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo
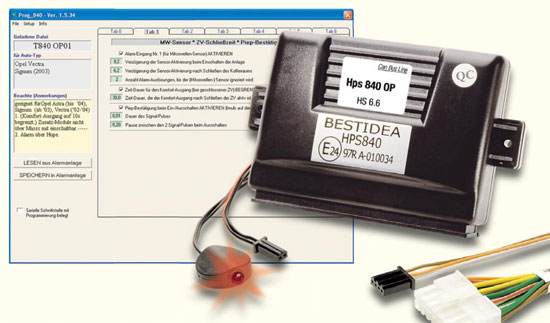




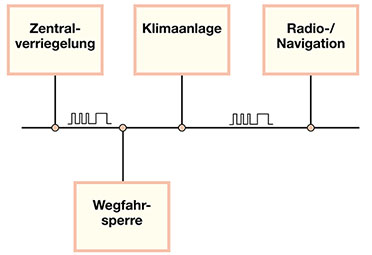
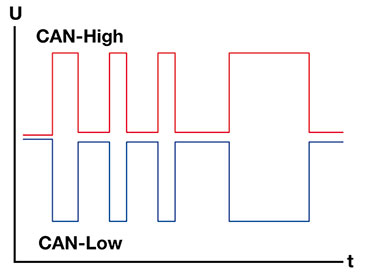
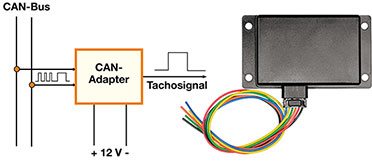


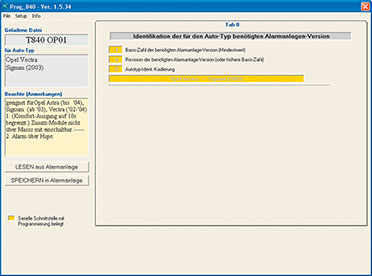
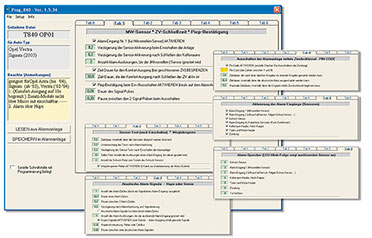

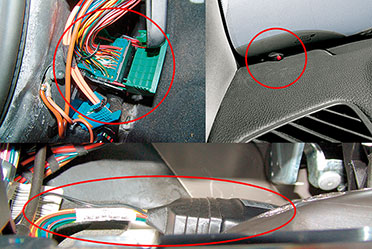
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)