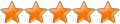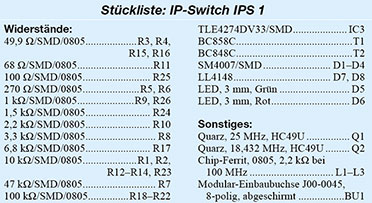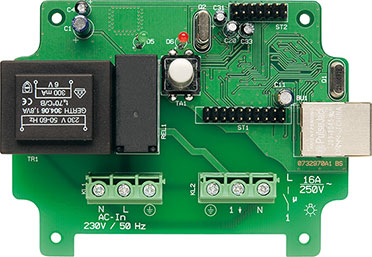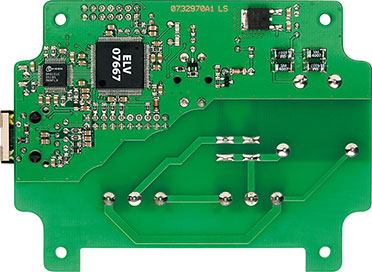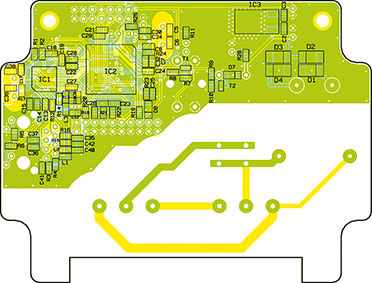Fernschalten per PC – IP-Switch IPS 1
Aus ELVjournal
04/2007
0 Kommentare
Technische Daten
| Schnittstellen | Ethernet, TCP/IP |
| Spannungsversorgung | 230 V/50 Hz |
| Relaisausgang | 230 V/50 Hz, max. 16 A |
| Leistungsaufnahme | 0,5 W |
| Abmessungen (B x H x T) | 115 x 56 x 90 mm |
Dank
DSL und moderner Routertechnik ziehen Computernetzwerke auch immer mehr
in Privathaushalte ein. Oftmals verrichtet hier sogar ein Server Tag
und Nacht seinen Dienst. Warum sollte man die einmal aufgebaute
Netzwerkstruktur nicht auch für die Hausautomatisierung nutzen? Der IPS 1
ist die erste Komponente einer neuen netzwerkfähigen Geräteserie, die
an das heimische Netzwerk angeschlossen werden kann. Der neue
Leistungsschalter kann Netzverbraucher mit einer Leistungsaufnahme von
bis zu 3680 W schalten. Er wird einfach an ein vorhandenes Netzwerk
angeschlossen, an die Netzwerkparameter angepasst und passwortgeschützt
über einen üblichen Internet-Browser angesprochen.Rückgrat Netzwerk
erlangen
lokale Netzwerke wie LAN oder WLAN einen immer größeren Stellenwert,
denn dank breitbandiger Internetzugänge sind immer mehr Privathaushalte
mit Netzwerktechnik ausgerüstet. Überwiegend kommen dabei Router mit
integriertem DSL-Modem und DHCP-Server zum Einsatz, wodurch die
Verwaltung und der Aufbau einfach zu handhaben sind. Denn diese
intelligenten Router erledigen das, wozu früher ein EDV-Fachmann zu Rate
gezogen werden musste – sie vollziehen viele der ehedem komplizierten
Netzwerkkonfigurationen automatisch, erfordern kein für den Normalnutzer
kryptisches Kommandozeilen-Chinesisch, sondern sind bequem per Webseite
erreichbar und in wenigen Schritten eingestellt. Die Infrastruktur für
ein Automatisierungssystem auf Netzwerkbasis ist also vorhanden und
könnte einfach genutzt werden. Zudem sind die Netzwerktechnologien
ausgereift und ermöglichen eine stabile und sichere Verbindung der
einzelnen Komponenten. Mit dem IPS 1 beginnend, stellen wir daher eine
Reihe von Netzwerkkomponenten vor, mit denen der (auch kostengünstige)
Aufbau eines LAN-gestützten Automatisierungssystems für jedermann
realisierbar ist. Der IPS 1 wird als eigenständiges Netzwerk- Gerät mit
einem handelsüblichen Netzwerkkabel ans Netzwerk angeschlossen und ist
an die vorhandenen Netzwerkparameter anpassbar. Dies erfolgt entweder
dynamisch-automatisch per DHCP oder durch manuelles Einstellen. Da der
IPS 1 über eine eigene, natürlich passwortgeschützte Webseite erreichbar
ist, ist das hiermit realisierbare Fernschalten nicht nur auf das
lokale Netzwerk begrenzt, selbstverständlich kann dies auch aus der
Ferne per Internet erfolgen. Damit verfügt man über ein weltweit
steuerbares und gegenüber anderen Technologien auch sehr
funktionssicheres (weil mit Zustandsmeldung versehenes)
Fernschaltsystem. Durch die Bedienung per Web-Browser ist der Betrieb
der Verbindung auch völlig systemunabhängig.Netzwerk-Grundlagen

|
| Bild
1: Prinzipaufbau eines lokalen Netzwerks mit Anbindung an das Internet.
Gleichzeitig ist hier die Adresszuweisung bei der Port-Weiterleitung
(siehe Text) dargestellt. |
Installation und Bedienung
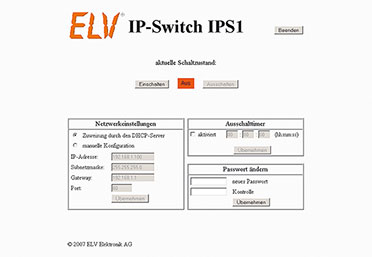
|
| Bild 2: Die Webseite des IPS 1 mit Konfigurationseinstellungen, Timer-Einstellfeld und Passwortvergabe |
Der
IP-Schalter wird zunächst mit dem Netzwerk verbunden und die
Spannungsversorgung hergestellt. Verfügt das Netzwerk über einen
DHCP-Server, so bezieht der IPS 1 seine IP-Adresse automatisch. Neuere
Routermodelle sind in der Regel mit einem DHCP-Server ausgestattet, bei
älteren Geräten ist dies nicht immer der Fall. Ein Blick in die
Bedienungsanleitung bringt hier Klarheit. Falls DHCP nicht verfügbar ist
oder nicht gewünscht wird, sind werkseitig folgende Einstellungen
programmiert:
IP-Adresse: 192.168.1.100
Netzmaske: 255.255.0.0
Gateway: 192.168.1.1
Sollte
vor Ort ein anderes Subnetz (z. B. 192.168.178.x) verwendet werden,
muss die Netzmaske des Routers auf 255.255.0.0 geändert werden, damit
der IP-Schalter erreichbar ist. Die Bedienung erfolgt über eine Webseite
(Abbildung 2), die man einfach durch Eingabe der IP-Adresse des Gerätes
(z. B. http://192.168.1.100) in einem Web- Browser aufruft. Sollte sich
der IP-Schalter per DHCP konfiguriert haben oder ist die fest
eingestellte IP-Adresse nicht mehr bekannt, ist sie über die
Windows-Eingabeaufforderung ermittelbar. Hier muss der Befehl „arp –a“
eingegeben werden, woraufhin eine Auflistung der vorhandenen IP-Adressen
und der zugehörigen MACAdressen (Hardware-Adressen) erscheint. Nun kann
nach der MAC-Adresse, die sich am Gehäuse befindet und mit 00-1A-22
beginnt, gesucht und die entsprechende IPAdresse abgelesen werden.
Alternativ kann man einen „IP-Scanner“ wie [1] oder [2] einsetzen. Diese
Programme sind Freeware und leicht anzuwenden.
Die
Webseite des IPS 1 ist übersichtlich gestaltet und stellt alle nötigen
Informationen und Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Der
Schaltzustand kann über die Buttons „Einschalten“ und „Ausschalten“
geändert werden, wobei der aktuelle Zustand über das farbige Feld
zwischen beiden Buttons angezeigt wird. Unter „Netzwerkeinstellungen“
sind die Netzwerkparameter manuell änderbar, wenn die DHCP-Unterstützung
ausgeschaltet ist. Bei aktiver DHCP-Unterstützung können die Parameter
nur abgelesen werden. Der IPS 1 verfügt über einen internen Timer, der
den Schalter nach einer einstellbaren Zeitdauer selbsttätig wieder
ausschaltet. Diese Funktion kann unter „Ausschalt-Timer“ aktiviert und
die gewünschte Zeitdauer (max. 23 h:59 min: 59 s) eingegeben werden. Um
einen unberechtigten Zugriff auf den IP-Schalter zu verhindern, verfügt
die Webseite über einen Passwort-Schutz, der über das entsprechende
Auswahlfeld eingeschaltet werden kann. Nach der Aktivierung erfolgt nach
der Eingabe der IP-Adresse (http://192.168.1.100) zuerst die Abfrage
des Passwortes, bevor die Webseite angezeigt wird. Im
Auslieferungszustand ist der Passwortschutz deaktiviert. Über den Taster
am Gerät kann man bei Bedarf den IPS 1 auch ohne Netzwerkverbindung
schalten. Besonders interessant ist der Einsatz eines Netzwerkschalters,
wenn man von unterwegs Geräte im Haus über das Internet ein- oder
ausschalten möchte. Auch dies ist mit dem IPS 1 möglich. Allerdings
müssen dafür einige Einstellungen im Netzwerk vorgenommen werden. Ein
DSL-Router bekommt vom DSL-Provider eine eindeutige Internet-IP-Adresse
zugewiesen. 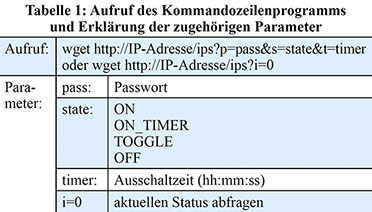
|
| Tabelle 1: Aufruf des Kommandozeilenprogramms und Erklärung der zugehörigen Parameter |
Schaltung
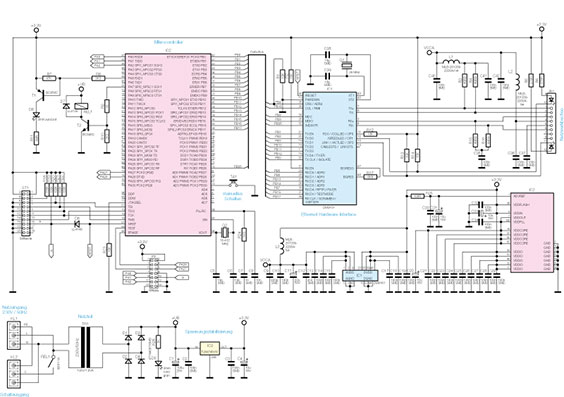
|
| Bild 3: Schaltbild des IPS 1 |
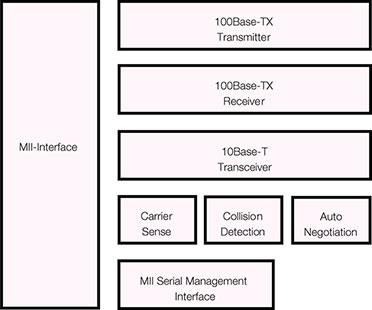
|
| Bild 4: Der Aufbau des DM9161 |
Nachbau
Da
alle SMD-Komponenten bereits werk seitig bestückt sind, beschränkt sich
der Nachbau auf das Bestücken der bedrahteten Bauteile und den Einbau
ins Gehäuse. Die Anschlüsse der bedrahteten Bauelemente werden durch die
entsprechenden Bohrungen der Platine geführt und auf der
Platinenrückseite verlötet. Bei den Elektrolyt-Kondensatoren und den
Leuchtdioden ist auf die richtige Polung zu achten. Elkos sind dabei
üblicherweise am Minus-Pol durch eine Gehäusemarkierung gekennzeichnet.
Die Katode der LEDs ist durch den jeweils kürzeren Anschluss zu
erkennen. Die LEDs D 5 und D 6 sind dabei mit einem Abstand vom 18,5 mm
(gemessen zwischen Gehäuseoberkante und Platine) einzulöten. Nun kann
der Taster TA 1 platziert und verlötet werden. Bei den Klemmen KL 1 und
KL 2, der Western- Modular-Buchse, dem Transformator und dem Relais ist
darauf zu achten, dass sie direkt auf der Leiterplatte aufliegen, so
dass die mechanische Beanspruchung der Lötstellen so gering wie möglich
ist. Die Anschlüsse der Schraubklemmen und die Kontaktanschlüsse des
Relais sind mit reichlich Lötzinn zu versehen. Damit ist der Aufbau der
Schaltung abgeschlossen und die gesamte Leiterplatte sollte nochmals auf
Bestückungsfehler und Lötzinnbrücken untersucht werden. Die Montage des
Gerätes beginnt mit dem Einlegen der Platine in das Gehäuse
(Schraubklemmen zeigen zu den Kabeldurchführungen). Als Nächstes wird
die Platine unter Zuhilfenahme der 4 Ab standsbolzen mit dem Gehäuse
verschraubt. Nun erfolgt das Einschrauben der Kabeleinführungen mit den
Gegenmuttern sowie die Verkabelung und Installation des Gerätes
entsprechend dem Abschnitt „Installation und Applikation“. Zum Schluss
ist noch die Neopren-Dichtung in den Gehäusedeckel einzuset zen, und
nach der Installation ist der Gehäusedeckel auf das Gehäuseunterteil
aufzusetzen und zu verschrauben. Dabei muss die Dichtung sorgfältig in
die entsprechende Nut eingelegt und am Ende auf die richtige Länge
gekürzt werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Dichtung
nicht zu kurz abgeschnitten wird. Außerdem muss der Schnitt genau
senkrecht verlaufen, damit Anfang und Ende der Dichtung in der Nut
bündig aneinander liegen.Installation und Applikation
Am
gewünschten Montageort befestigt man zunächst das Gehäuse über die vier
Montagebohrungen in den Gehäuseecken. Der Montageort muss vor dem
Einfluss von Feuchtigkeit geschützt sein, das Gerät darf also nur in
trockenen Innenräumen und im geschützten Außenbereich eingesetzt werden.
Die Verkabelung des Netz- und Lastanschlusses darf nur mit starren,
fest verlegten Installationsleitungen, die entsprechend der
anzuschließenden Last zu dimensionieren sind, erfolgen. Der
Netzstromkreis, an den das Gerät angeschlossen wird, ist stromlos zu
schalten und so zu sichern, dass kein unbefugtes Wiedereinschalten
erfolgen kann. Die Leitungsenden werden auf 6 mm abisoliert, dann die
Gegenmuttern der Kabelverschraubungen über die Leitungen gestreift, die
Leitungen durch die Kabelverschraubungen geführt und in den zugehörigen
Schraubklemmen sorgfältig verschraubt. Anschließend erfolgt das Fixieren
der Kabel durch Festdrehen der Kabelverschraubungen. Selbstverständlich
gehört zu einer fachlich exakten Installation, dass auch der
Verbraucher VDE-gerecht angeschlossen und ausgeführt ist! Abschließend
wird die Frontplatte auf die Abstandsbolzen der Grundplatine aufgesetzt
und mit den vier Kunststoffschrauben verschraubt. Nun kann man die
Netzspannung zuschalten und einen Funktionstest des Gerätes durchführen,
indem man es mit dem Bedientaster TA 1 schaltet. Die LED D 6 leuchtet
bei geschaltetem Relais auf. Nach diesem Funktionstest ist die
Netzspannung wieder abzuschalten und das Gehäuse wird mit dem
Gehäusedeckel verschlossen und verschraubt. Nun ist nur noch die
seitliche RJ45- Buchse über ein normales Netzwerkkabel mit dem nächsten
Netzwerkanschluss, dem Router oder einem Netzwerkverteiler (Switch) zu
verbinden. Nach dem Zuschalten der Netzspannung ist das Gerät mit den
erwähnten Werkseinstellungen bereit zum Betrieb bzw. zur Konfiguration.Achtung!
Aufgrund
der im Gerät frei geführten Netzspannung und den erforderlichen
Installationsarbeiten am 230-V-Stromnetz dürfen Aufbau und
Inbetriebnahme ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden, die
aufgrund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen
Sicherheits- und VDEBestimmungen sind unbedingt zu beachten. Außerdem
ist bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät, z. B. bei der Reparatur, ein
Netz-Trenntransformator zu verwenden.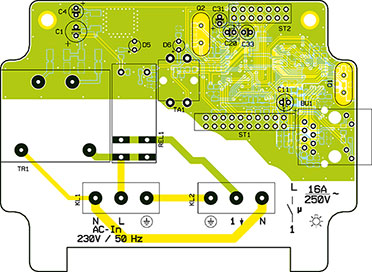
|
| Ansicht
der fertig bestückten Platine des IPS 1 mit zugehörigem
Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (6 Seiten)
als PDF (6 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Fernschalten per PC – IP-Switch IPS 1
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo






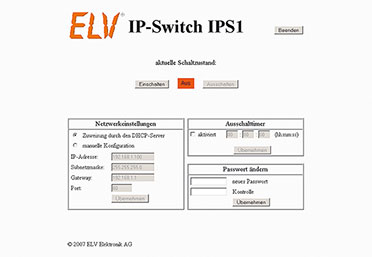
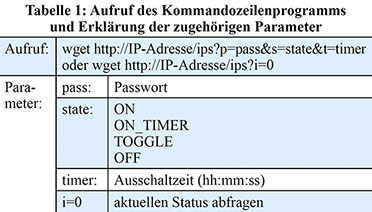
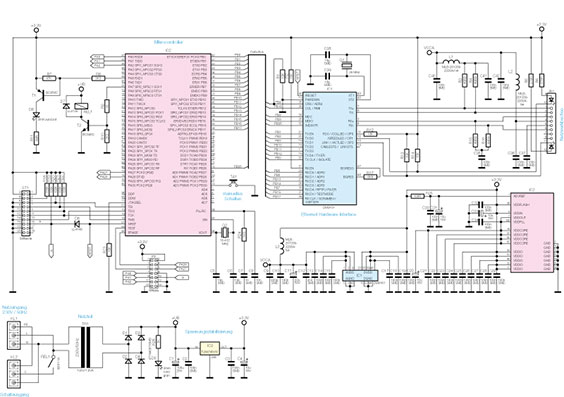
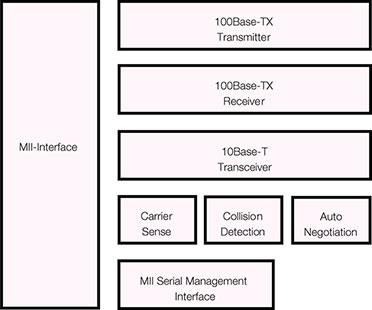
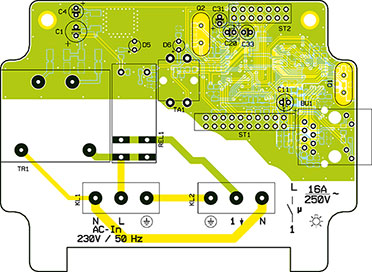
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (6 Seiten)
als PDF (6 Seiten)