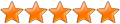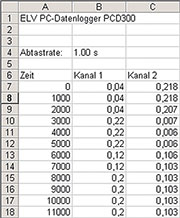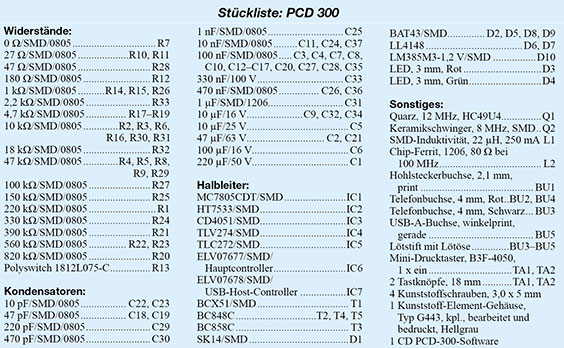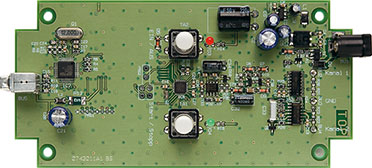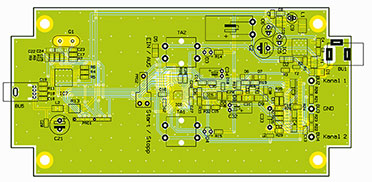USB-PC-Datenlogger PCD 300
Aus ELVjournal
04/2007
0 Kommentare
Technische Daten
| Mess-Eingang 1: | |
| Spannungsbereich/ Auflösung | 0–5 VDC/20 mV |
| Genauigkeit | 1 % ± 20 mV* |
| Abtastrate | 50 ms – 60 s |
| Eingangsimpedanz | 1,2 MΩ |
| |
| Mess-Eingang 2: | |
| Spannungsbereich/ Auflösung | 0–5 VDC/1 mV |
| Genauigkeit | 0,5 % ± 1 mV* |
| Abtastrate | 200 ms – 60 s |
| Eingangsimpedanz | 1,1 MΩ |
| |
| Allgemein: | |
| Schnittstelle | USB |
| Spannungsversorgung | 9–12 VDC/max. 15 VA |
| Stromaufnahme im Stand-by-Betrieb | 40 mA |
| Max. Stromaufnahme | 150 mA |
| Abmessungen (B x H x T): | 80 x 150 x 30 mm |
| Betriebssystem | MS Windows 98/2000/
XP |
| * Die Genauigkeiten hängen direkt vom Abgleich ab und können nur nach einem exakten Abgleich eingehalten werden. | |
Die
Aufzeichnung von Messdaten über lange Zeiträume kann heute recht bequem
über ein Multimeter mit PC-Schnittstelle und einen daran
angeschlossenen PC erfolgen. Was aber, wenn am Messort kein PC zur
Verfügung steht? Dann schlägt die Stunde der Datenlogger! Unser neuer
USB-Datenlogger muss zum Konfigurieren und Auslesen der Daten nicht
einmal mehr zum PC getragen werden – Mess- und Konfigurationsdaten sind
auf einem normalen USB-Stick beliebiger Speicherkapazität speicherbar,
der dann den Datentransport in beide Richtungen übernimmt. Somit
arbeitet der neue PCD 300 völlig autark vom PC!Daten sammeln in neuer Qualität
Die
Anschaffung eines Messgerätes mit internem Datenlogger ist in aller
Regel mit hohen Kosten verbunden, zudem ist die Speicherkapazität
interner Speicherlösungen oftmals nicht ausreichend, womit die meisten
dieser Datenlogger für Langzeitmessungen nicht in Frage kommen. Günstige
Alternativen bieten Multimeter in Kombination mit einem PC. Hier werden
die Daten nur vom Multimeter erfasst, digitalisiert, an den PC
übertragen und dort gespeichert. Ist am Arbeitsplatz kein PC vorhanden
oder reicht die Akku-Laufzeit des Notebooks nicht für Langzeitmessungen,
entfällt auch diese Alternative. Die Lösung besteht nun in einem autark
arbeitenden Datenlogger, der, möglichst auf mehreren Kanälen, Daten
erfassen und in einem möglichst großen Speicher ablegen kann. Nach
Abschluss der Erfassung schließt man dann den Datenlogger an einen PC an
und liest die Daten aus. Praktischerweise konfiguriert man den
Datenlogger auch gleich per PC, bevor dieser zu seinem nächsten Einsatz
kommt. Solche Geräte der ersten Generation sind die ELV-PCD 100/200 (mit
RS232- bzw. USBSchnittstelle). So praktisch diese sind, für so manchen
Einsatz weisen sie zwei Mankos auf: Zum einen müssen sie zum
Konfigurieren und Auslesen immer noch zum PC transportiert werden. Das
ist bei manchen Anwendungen, bei denen der Datenlogger quasi ortsfest an
seinem Einsatzort angeschlossen bleiben sollte, äußerst lästig, wenn
nicht unmöglich. Zum anderen ist auch der Speicherplatz dieser Geräte
durch den fest installierten Speicher begrenzt, so ist etwa beim PCD 200
bei immerhin sehr akzeptablen 270.000 Messungen Schluss! Dass das in
der Praxis mitunter lange nicht ausreicht, zumal bei der Erfassung auf
gleich zwei Messkanälen, liegt bei vielen heutigen Erfassungsvorgängen
auf der Hand. Eine flexible Lösung musste her! So entstand der hier
vorgestellte PCD 300. Er braucht niemals, nicht einmal zum Abgleich, an
einen PC angeschlossen zu werden, denn er benutzt einen der heute in
rasant steigender Kapazität verfügbaren, preiswerten USB-Speichersticks
als Speichermedium und zum Datentransport in beide Richtungen. Und eine
intelligente Firmware ermöglicht den autarken Abgleich, der lediglich
eine genaue Referenzspannung erfordert. Durch die stetig wachsenden
Kapazitäten der USB-Sticks bei ständig fallenden Preisen erhält man hier
eine äußerst flexible, leistungsfähige und zudem preiswerte
Speicherlösung. Der PCD 300 bietet die Möglichkeit, auf zwei Kanälen
Gleichspannungen von 0 V bis 5 V zu messen, zu digitalisieren und auf
dem USB-Stick zu speichern. Der PCD 300 ist zur Anpassung an die
individuelle Messaufgabe hinsichtlich der Kanaleinstellung, der
Abtastrate und der Triggerbedingungen einfach über die mitgelieferte
PC-Software konfigurierbar. Die programmierte Konfi- guration wird auf
dem USBStick gespeichert und beim Anschluss an den PCD 300 übernommen.
Das Abspeichern der Messwerte erfolgt in einer „slk“-Datei, die von
gängigen Tabellenkalkulations- Programmen (z. B. Microsoft Excel)
auswertbar ist. Mit einem solchen Programm sind die Daten auch als
Grafik visualisierbar. Häufig treten Fehler in einer Schaltung in
unregelmäßigen Abständen auf, so dass sich die Fehlersuche hier in
vielen Fällen sehr schwierig gestaltet. Mit dem PCD 300 kann man bis zu
zwei Spannungen über einen langen Zeitraum beobachten und auswerten, so
dass die Analyse eventueller Fehler einfacher wird. Jedoch ist der
Anwendungsbereich für den PC-Datenlogger noch viel größer, denn mittels
entsprechender Messwandler sind auch andere physikalische Größen wie z.
B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck, Strom erfassbar. Ein
entsprechender Messwandler muss lediglich die zu messende Größe in eine
Spannung von 0 V bis zu 5 V umsetzen. Zusätzlich bietet der PCD 300
einen Trigger, der die Speicherung der Messwerte automatisch startet,
sobald die festgelegte Triggerspannung über- bzw. unterschritten wird.
Die Trigger-Parameter sind über die PC-Software konfigurierbar. Somit
ist der Datenlogger auch ereignisorientiert einsetzbar.Software-Installation
Zunächst
ist die PC-Software auf einem Rechner mit USB-Schnittstelle zu
installieren. Hierzu wird das Installationsprogramm „setup.exe“ von der
mitgelieferten CDROM gestartet und somit das Anwendungsprogramm auf dem
Rechner installiert. Zum Konfigurieren bzw. Auslesen von Daten ist der
USBStick an einen freien USB-Port des Rechners anzuschließen. Er
erscheint kurz danach als zusätzliches Laufwerk auf dem Desktop.Bedienung und Funktion
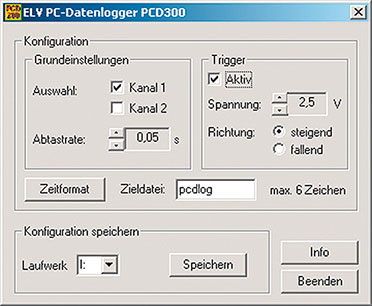
|
| Bild 1: Das Hauptfenster der PC-Software |
Die
Bedienung am Gerät wird über zwei Tasten (EIN/AUS; START/STOPP)
vorgenommen, die beiden LEDs (Rot = Betrieb, Grün = aktiv) signalisieren
den Status des Gerätes. Die notwendige Konfiguration erfolgt einfach
und unkompliziert über die zugehörige PC-Software und macht daher
zusätzliche Bedienelemente überflüssig. Die Einstellungen sind
übersichtlich im Hauptfenster der Anwendung (Abbildung 1) vorzunehmen.
Nach dem Start des Programms werden zunächst die Grundeinstellungen, d.
h. die Auswahl von Kanal und Abtastrate, vorgenommen. Hier zeigen sich
Unterschiede zwischen den beiden Kanälen:
Kanal 1 → 20 mV Auflösung, Abtastrate max. 0,05 s
Kanal 2 → 1 mV Auflösung, Abtastrate max. 0,2 s
Jetzt
kann man die Triggerfunktion durch Anklicken des entsprechenden Feldes
aktivieren. Hierdurch werden die Einstellungen der Triggerspannung und
-flanke freigeschaltet. Bei eingeschaltetem Trigger erfolgen nach dem
Start des Datenloggers die Messungen des anliegenden Signals mit der
programmierten Abtastrate, jedoch werden die gemessenen Daten nicht
abgespeichert. Sobald die Spannung des Eingangssignals den eingestellten
Wert der Triggerspannung über- (steigend) bzw. unterschreitet
(fallend), werden die in der Folge erfassten Messwerte im Datenspeicher
abgelegt. Diese Funktion ist bei der Fehlersuche sehr hilfreich, so dass
z. B. die Datenaufnahme erst beim Absinken der Betriebsspannung eines
Gerätes gestartet (getriggert) wird.
In
das Eingabefeld „Zieldatei“ kann man den Namen der „slk“-Datei
eingeben. Bei jedem Starten einer Messung wird eine neue Datei mit dem
angegebenen Dateinamen und einer laufenden Nummer erzeugt. Durch einen
Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ wird eine Konfigurationsdatei auf
dem ausgewählten Laufwerk (USBStick) gespeichert. Das war’s – nun kann
man den USB-Stick vom PC trennen und an den PCD 300 anstecken. Vorher
muss der Datenlogger jedoch durch einen kurzen Tastendruck der
EIN/AUS-Taste eingeschaltet werden. Der Datenlogger initialisiert nun
die USBSchnittstelle, dies wird durch die blinkende rote LED
signalisiert. Ist die Initialisierung abgeschlossen, leuchtet die rote
LED dauerhaft, die grüne LED blinkt. Nun kann der USB-Stick angesteckt
werden. Es folgt die Initialisierung des USB-Sticks und das Auslesen der
Konfigurationsdatei. Je nach Speicherkapazität und verwendetem
Dateisystem (FAT16 oder FAT32) kann dies einige Sekunden dauern. Nach
erfolgreichem Abschluss erlischt die grüne LED. Die Konfigurationsdaten
werden zusätzlich im internen EEPROM des Datenlogger- Mikrocontrollers
gespeichert und stehen damit auch zur Verfügung, wenn der angeschlossene
USB-Stick keine Konfigurationsdatei enthält. Bei gleich bleibenden
Rahmenbedingungen muss also in der Folge nicht zwingend eine
Konfigurationsdatei vorhanden sein – das macht die Handhabung einfacher.
Die Messung kann jetzt am PC-Datenlogger durch einen kurzen Tastendruck
der START/STOPP-Taste gestartet werden. Auf dem USB-Stick wird nun eine
neue Datei erstellt und geöffnet. Die grüne „Aktiv“-LED zeigt den
Status der Datenaufnahme an. Solange diese LED blinkt, ist bei aktivem
Trigger die Triggerbedingung noch nicht aufgetreten und die gemessenen
Daten werden noch nicht im Speicher des USB-Sticks abgelegt. Nachdem die
Triggerbedingung eingetreten ist, leuchtet die LED dauerhaft und die
Daten werden nun gespeichert. Bei abgeschalteter Triggerfunktion erfolgt
die Speicherung der Messwerte von Beginn an, und die grüne Status-LED
leuchtet von Anfang an. Über einen langen Tastendruck der
START/STOPP-Taste (ca. 2 Sekunden) wird die laufende Aufnahme beendet
und die erstellte Datei geschlossen. 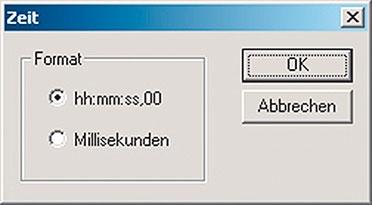
|
| Bild 2: Die Zeitformat-Einstellung |
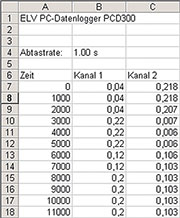
|
| Bild 3: Die Zeitformat-Auswahl in Millisekunden |
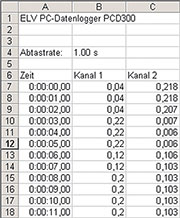
|
| Bild 4: Die Zeitformat-Auswahl in Stunden: Minuten:Sekunden,Millisekunden |
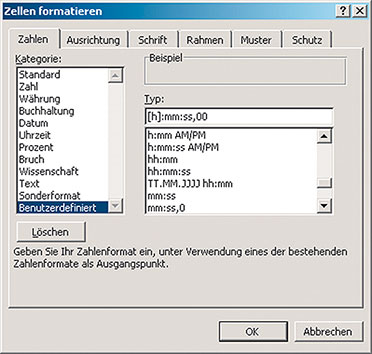
|
| Bild 5: Die Zellenformatierung mit Microsoft Excel |
Schaltung
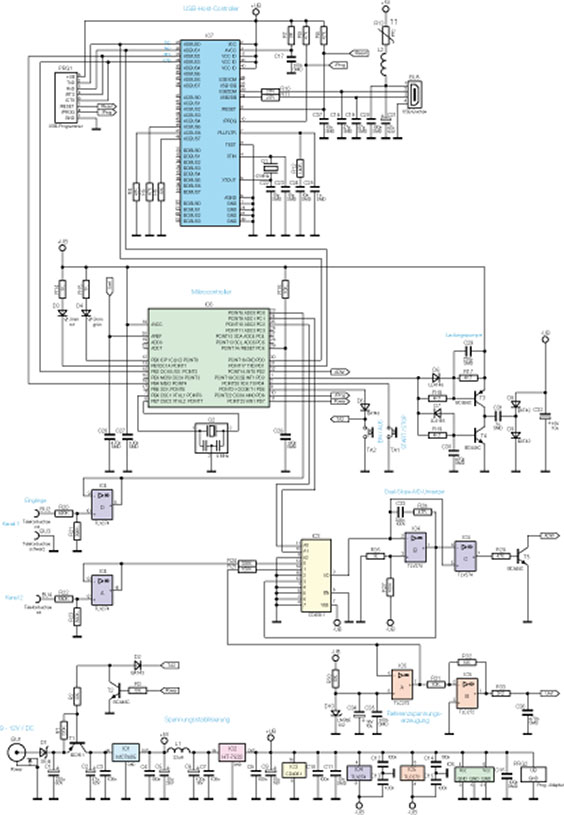
|
| Bild 6: Das Schaltbild des PCD 300 |
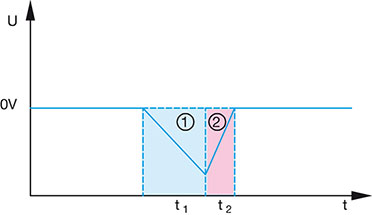
|
| Bild 7: Das Zwei- Rampen-Verfahren der A/D-Umsetzung |
Nachbau
Aufgrund
des hohen Anteils an SMDKomponenten, die bereits alle werkseitig
bestückt worden sind, beschränkt sich der Nachbau auf das Bestücken der
bedrahteten Bauteile und den Einbau in das Gehäuse. Die Anschlüsse der
bedrahteten Bauelemente werden durch die entsprechenden Bohrungen der
Platine geführt und auf der Platinenrückseite verlötet. Bei den
Elektrolyt-Kondensatoren und den Leuchtdioden ist auf die richtige
Polung zu achten. Elkos sind dabei üblicherweise am Minus-Pol durch eine
Gehäusemarkierung gekennzeichnet. Die Katode der LEDs ist durch den
jeweils kürzeren Anschluss zu erkennen. Die LEDs sind in einem Abstand
von ca. 23,5 mm zwischen Spitze und der Oberfläche der Leiterplatte
einzulöten. Im Anschluss daran werden die beiden Taster und die beiden
Buchsen (BU 1, BU 5) an ihrem Platz montiert und verlötet. Hier ist
besonders darauf zu achten, dass deren Gehäuse direkt auf der
Leiterplatte aufliegen, so dass die mechanische Beanspruchung der
Lötstellen so gering wie möglich ist. Bevor die Schaltung in das Gehäuse
eingebaut wird, sollte man die gesamte Leiterplatte nochmals auf
Bestückungsfehler und Lötzinnbrücken untersuchen. Die Lötösen für BU 2
bis BU 4 werden parallel zur kurzen Seite der Leiterplatte eingelötet
und die Kappen auf die beiden Taster gepresst. Nun wird die Leiterplatte
in die untere Halbschale des Gehäuses eingelegt und verschraubt. Im
Anschluss daran werden die Telefonbuchsen in die Stirnplatte eingesetzt
und mit der Kontermutter befestigt. Es ist darauf zu achten, dass BU 3
mit einer schwarzen und BU 2 bzw. BU 4 mit einer roten Buchse bestückt
werden. Nun wird die Stirnplatte eingesetzt und die Lötanschlüsse der
Telefonbuchsen werden mit reichlich Lötzinn direkt mit den Ösen
verbunden. Danach wird die obere Halbschale so aufgelegt, dass die
beiden Tasterstößel und die LEDs durch die zugehörigen Bohrungen der
Oberschale ragen. Nun erfolgt das Verschrauben des Gehäuses mit den vier
Gehäuseschrauben.Inbetriebnahme und Abgleich
Die
Spannungsversorgung erfolgt über ein Steckernetzteil, das an die
DC-Buchse des Gerätes angeschlossen wird und eine Gleichspannung
zwischen 8 und 12 V liefern muss. Zunächst wird der Datenlogger mit der
Betriebsspannung verbunden und die Stromaufnahme des Gerätes geprüft.
Nach dem Einschalten muss die gemessene Stromstärke geringer sein als
die in den technischen Daten angegebene maximale Stromaufnahme. Jetzt
folgt der Abgleich der beiden Kanäle, für den eine sehr präzise
5-V-Referenzspannung notwendig ist. Die spätere Messgenauigkeit hängt
direkt von der sorgfältigen Durchführung dieses Abgleichs ab. Nach einem
ungenauen Abgleich kann der PC-Datenlogger die in den technischen Daten
angegebenen Toleranzen nicht einhalten. Um den Abgleich zu starten,
wird im ausgeschalteten Zustand die START/ STOPP-Taste gedrückt und
festgehalten und dann der EIN/AUS-Taster betätigt. Die START/STOPP-Taste
bleibt dabei weiterhin gedrückt. Nach etwa 5 Sekunden beginnt die grüne
LED zu leuchten. Im ersten Schritt sind beide Mess-Eingänge über kurze
Leitungen mit der GND-Buchse zu verbinden, um den Offset des Analog-
Digital-Umsetzers auszumessen. Sobald die Verbindungen hergestellt sind,
kann man die Messung mit einem Druck der START/STOPP-Taste starten.
Nachdem dieser Schritt erfolgreich abgeschlossen ist, erlischt die grüne
LED und die rote LED beginnt zu leuchten. Nun sind beide Eingänge mit
der 5-VReferenzspannung zu verbinden. Auch hier wird die Messung wieder
durch einen kurzen Druck auf die START/STOPP-Taste gestartet. Nachdem
auch dieser Abgleichschritt erfolgreich abgeschlossen ist, leuchten
beide LEDs für eine Sekunde auf und der PCD 300 schaltet sich ab. Der
Abgleich kann kontrolliert werden, indem man eine Messreihe, wie unter
„Bedienung und Funktion“ beschrieben, aufnehmen und auslesen lässt.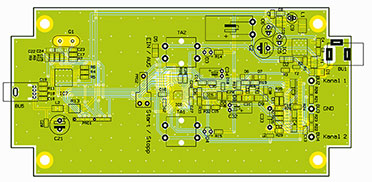
|
| Ansicht der fertig bestückten Platine des PCD 300 mit zugehörigem Bestückungsplan |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (6 Seiten)
als PDF (6 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- USB-PC-Datenlogger PCD 300
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo





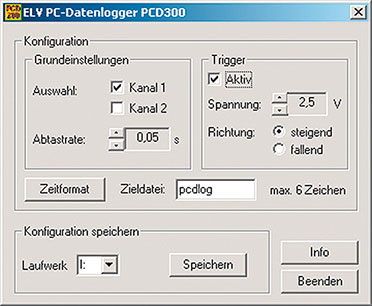
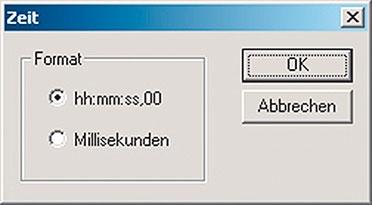
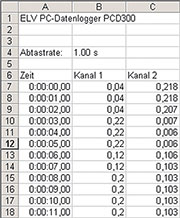
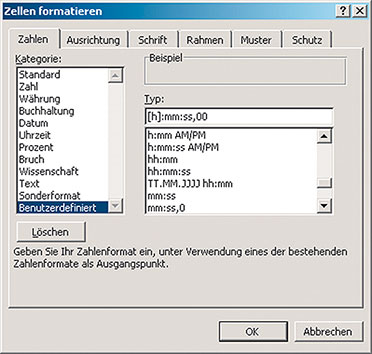
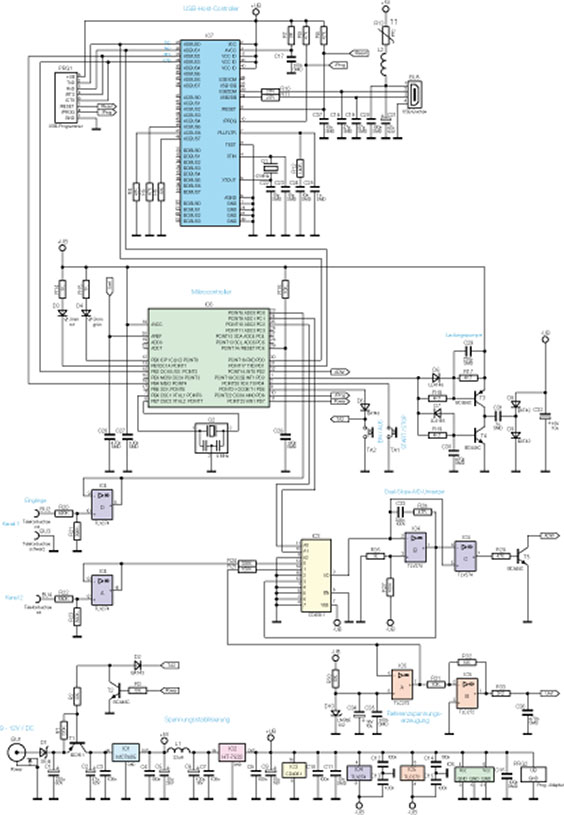
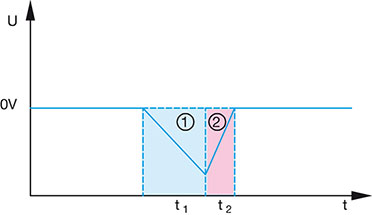
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (6 Seiten)
als PDF (6 Seiten)