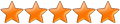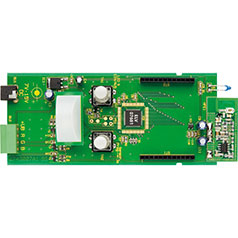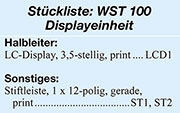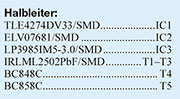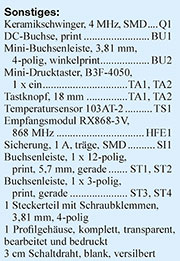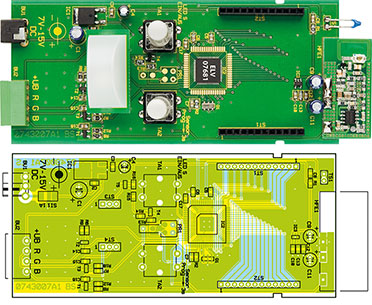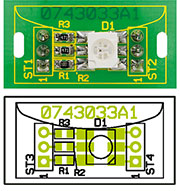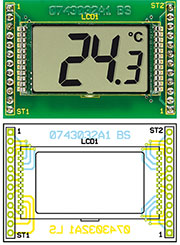Wetterstations-Templight WST 100 – Ein Blick genügt!
Aus ELVjournal
04/2007
0 Kommentare
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 7–15 VDC |
| Stromaufnahme (ohne ext. Last) | max. 100 mA |
| Ausgangsstrom | max. 0,5 A pro Kanal |
| DC-Versorgungsanschluss | Hohlstecker Außen-ø 3,5 mm,
Innen-ø 1,3 mm |
| Temperaturbereich | -20 bis + 50 °C |
| Kompatible Sensoren | Funk-Kombi-Sensor KS 200/KS 300,
Funk-Innen-/Außensensor S 300 IA,
Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor
ASH 2200, Pool-Sensor PS50 |
| Abmessungen Gehäuse (B x H x T) | 58 x 143 x 24 mm |
Ob
Innen- oder Außentemperatur oder die Temperatur des Pools, ein Blick
genügt, und schon weiß man, ob die persönliche „Wohlfühltemperatur“
vorhanden ist. Das WST 100 empfängt die Temperaturdaten von
ELV-Funk-Wettersensoren und stellt diese mittels einer RGB-Leuchtdiode
in verschiedenen Farben dar. Dabei ist es durch das Setzen von
Temperaturgrenzen möglich, die Farbausgabe an das persönliche
Temperaturempfinden anzupassen. Mit einer internen Temperaturmessung ist
sogar der Betrieb ohne Funk-Wettersensoren möglich. Zusätzlich erlaubt
eine kleine Endstufe den Anschluss von LED-Stripes mit einer
Stromaufnahme von bis zu 0,5 A je Farbe und damit sogar „Großanzeigen“.Im grünen Bereich
Nicht
immer interessiert bei der Einschätzung einer Temperatursituation der
genaue Temperaturwert, vielmehr will man wissen, ob die Temperatur im
eigenen Sinne „stimmt“. Beispiele dafür fallen jedem sicher schnell ein –
von der als angenehm empfundenen, meist aber immer unterschiedlichen
Temperatur in Wohnzimmer, Bad oder Schlafzimmer bis hin zur
Wassertemperatur des Swimmingpools, des Koi-Teichs oder sogar Aquariums
oder Terrariums ist hier alles denkbar. Weitere Beispiele wären etwa der
Weinkeller, das Gewächshaus, der Tiefkühlschrank, diverse
Flüssigkeitstemperaturen usw. Deshalb liegt es nahe, für diese
Anwendungsbereiche eine ganz andere Temperaturanzeige zu wählen, eine,
die lediglich einen bestimmten Temperaturzustand inklusive einer
gewissen Schwankungsbreite kennzeichnet. Und da bietet sich als Anzeige
im LED-Zeitalter natürlich die RGB-LED an, die es einfach macht, nahezu
das gesamte sichtbare Farbspektrum nahtlos darzustellen. Mit ihr ist es
möglich, bei entsprechender Ansteuerung bestimmten Temperaturen
bestimmte Leuchtfarben zuzuordnen, so dass man bereits aus größerer
Entfernung tatsächlich erkennen kann, ob sich eine bestimmte Temperatur
„im grünen Bereich“ befindet. Eine solche Anzeige ist, zumal, wenn sie
wirklich gut sichtbar platziert und ausgeführt ist, weithin erkennbar
und einfach eindeutig – man muss nicht an das Display herantreten, um
die Temperatur abzulesen.Genau
diese Aufgabe erfüllt das neue ELV-Templight. Aber das interessante
Gerät kann noch mehr! Es verfügt nicht nur über einen internen Sensor,
der die Erfassung der Raumtemperatur möglich macht, über einen
Funkempfänger kann es die Daten nahezu aller aktuellen ELV-Funk-
Temperatursensoren, z. B. auch des Kombi- Sensors KS 300 oder des
Pool-Sensors PS 50 empfangen und anzeigen (alle einsetzbaren Typen sind
im Abschnitt „Bedienung“ aufgeführt). So kann man die vorhandenen
Sensoren seiner ELV-Wetterstation einfach mitnutzen. Für jeden der
Sensoren ist ein individueller Temperaturbereich einstellbar, so dass
bei der Abfrage eben z. B. „Grün“ für jeden Sensor das Gleiche bedeutet:
Temperatur o. k.! Dabei erleichtert ein kleines LC-Display alle
Einstellungen. Wem die interne RGB-Leuchtdiode nicht ausreicht, für den
steht zusätzlich ein Leistungs-Ausgang für eine Belastung von bis zu 0,5
A je Farbkanal zur Verfügung, an den sich leistungsfähige RGB-Einheiten
anschließen lassen, etwa RGB-Stripes. Diese sind dann im wahrsten Sinne
des Wortes als Großanzeige nutzbar, womit sich Erkennbarkeit und
Reichweite nochmals erhöhen. Und wer will, kann diese Stripes dann auch
noch gleichzeitig als Dekorationsleuchte einsetzen – die macht dann die
Verfolgung der Entwicklung der Außentemperatur an einem langen
Fernsehabend quasi zur Unterhaltung … Schließlich ist es auch noch
möglich, die interne und/oder externe Anzeige nach Belieben zu- und
abzuschalten, so ist das Gerät etwa auch im Schlafzimmer einsetzbar,
ohne im Schlaf zu stören – und auf einen Tastendruck nach dem Aufwachen
erfährt man sofort, ob es etwa draußen friert. Bedienung
Die
komplette Bedienung des Wetterstations- Templights erfolgt mit den
beiden Tasten TA 1 (LEDs EIN/AUS) und TA 2 (SENSOR/PROG–>3s).LEDs ein-/ausschalten

|
| Bild 1: Anzeige des aktuellen Modus |
Mit
der Taste TA 1 (LEDs EIN/AUS) ist es möglich, die im Gerät befindliche
RGB-LED D 1 allein oder alle LEDs abzuschalten. Ein kurzer Druck auf die
Taste TA 1 zeigt auf dem Display, wie in Abbildung 1 zu sehen ist, den
aktuellen Modus für 3 Sekunden an. Folgende Modi sind einstellbar:
L0: interne und externe LEDs abgeschaltet
L1: interne LED abgeschaltet, externe LEDs eingeschaltet
L2: interne und externe LEDs eingeschaltet
Betätigt
man innerhalb dieser 3 Sekunden die Taste TA 1 nochmals kurz, so wird
damit die interne LED ein- bzw. ausgeschaltet. Um alle angeschlossenen
LEDs abzuschalten, ist die Taste TA 1 länger als 3 Sekunden zu
betätigen. Anschließend wird auf dem Display der nun aktivierte Modus L0
angezeigt. Zum Einschalten der LEDs reicht danach ein kurzes Drücken
der Taste TA 1.
Auswahl des Sensors

|
| Bild 2: Anzeige des aktuell genutzten Sensors (hier S3) |
Um
das WST 100 auf eine bestimmte Sensoradresse einzustellen, ist mit der
Taste TA 2 (SENSOR) der gewünschte Sensor auszuwählen. Durch kurzes
Betätigen der Taste TA 2 ändert sich die Anzeige auf dem Display und
zeigt die momentan verwendete Sensoradresse für 3 Sekunden an (siehe
Abbildung 2). Wird innerhalb dieser 3 Sekunden die Taste TA 2 nochmals
betätigt, wechselt das Gerät zur nächsten Sensoradresse, z. B. von S3 zu
S4. Hierbei ist Folgendes festgelegt:
- Sensoradresse S0 ist immer der interne Temperatursensor
- Sensoradresse S9 ist immer der Funk- Kombi-Sensor KS 200/300
- Auf den Sensoradressen S1 bis S8 sind je nach Adressierung die Sensoren S 300 IA, ASH 2200 oder PS50 zu empfangen
Einstellung der Wohlfühltemperatur

|
| Bild 3: Der Farbverlauf der Anzeige von Blau (zu kalt) über Grün (Wohlfühltemperatur) bis Rot (zu warm) |

|
| Bild 4: Eingabe der unteren Temperaturgrenze (hier –2 °C) |

|
| Bild 5: Eingabe der oberen Temperaturgrenze (hier 23 °C) |
Schaltungsbeschreibung
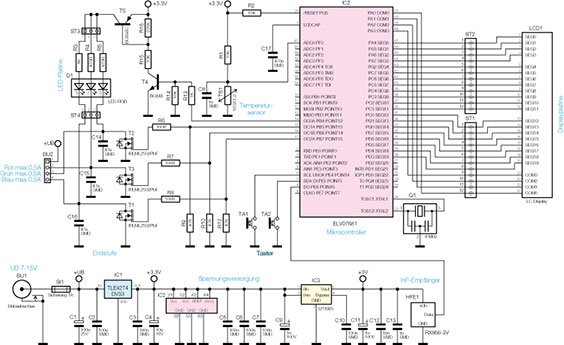
|
| Bild 6: Schaltbild des WST 100 |
Displayplatine
Auf
der Displayplatine sind das Display LCD 1 und die beiden 12-pol.
Stiftleisten ST 1 und ST 2 untergebracht. Mit Hilfe dieser
Displayplatine wird das Display LCD 1 so weit angehoben, dass es sich
direkt unter der Gehäuseoberschale befindet und somit gut abgelesen
werden kann.LED-Platine
Auf
der LED-Platine befinden sich neben der RGB-LED D 1 und den drei
Vorwiderständen R 3, R 4 und R 5 zusätzlich noch eine LED-Abdeckung und
die Stiftleisten ST 3, ST 4. Mit diesen Stiftleisten und den
dazugehörigen Buchsenleisten ST 3 und ST 4 auf der Basisplatine wird
auch diese LED-Platine so weit angehoben, dass die LED-Abdeckung aus dem
Gehäuseoberteil herausragt. So ist das Leuchten der RGB-LED in einem
großen Sichtwinkel zu erkennen. Das diffuse Material der LED-Abdeckung
unterstützt die additive Farbmischung der drei RGB-LED-Grundfarben.Basisplatine
Die
gesamte restliche Elektronik befindet sich auf der Basisplatine. Als
Spannungsversorgung kann eine unstabilisierte Gleichspannung von 7 V bis
15 V verwendet werden, die über die Buchse BU 1 zugeführt wird. Die
Sicherung SI 1 schützt ein angeschlossenes Netzteil im Fehlerfall vor
einem Defekt. Aus dieser Betriebsspannung +UB erzeugt der
Spannungsregler IC 1 vom Typ TLE4274DV33 eine stabilisierte Spannung von
+3,3 V, die für den Betrieb des Mikrocontrollers IC 2 benötigt wird.
Der eingesetzte Controller ist ein ATmega169PV, der speziell für die
direkte Ansteuerung von LC-Displays ausgelegt ist. Dadurch ist es dem
Controller möglich, das über die Buchsenleisten ST 1 und ST 2
angeschlossene Display LCD 1 ohne weitere Peripherie zu treiben. Die
Taktfrequenz des Controllers wird vom externen Keramikschwinger Q 1
bestimmt, der mit einer Frequenz von 4 MHz schwingt. Als interner
Temperatursensor kommt der NTC-Widerstand TS 1 vom Typ 103AT-2 zum
Einsatz. Dieser auch Thermistor genannte Temperatursensor weist einen
negativen Temperatur-Koeffizienten auf, d. h. bei steigender Temperatur
sinkt der Widerstand. Ein wesentlicher Vorteil dieses Sensors besteht
darin, dass für alle Temperaturen im Bereich von -50 bis +100 °C die
Widerstandswerte des Sensors bekannt sind. Der Mikrocontroller IC 2 ist
somit ganz einfach mit Hilfe des internen A/DWandlers in der Lage, den
Widerstandswert des Temperatursensors zu ermitteln und ohne Abgleich,
anhand einer gespeicherten Tabelle die aufgenommene Temperatur zu
errechnen. Bei einer Temperatur von 25 °C nimmt der 103AT-2 einen
Widerstandswert von genau 10 kΩ an. Zum Empfang von externen Sensordaten
wird der HF-Empfänger RX868-3V eingesetzt, dieser benötigt für seinen
Betrieb eine Betriebsspannung von +3 V, die mit dem
Ultra-Low-Drop-Spannungsregler IC 3 erzeugt wird. Die vom HFE 1
empfangenen externen Sensordaten werden über die Datenleitung DATA zum
Pin 8 des Mikrocontrollers geführt. Aus den intern berechneten oder
extern empfangenen Temperaturwerten werden mittels PWM-Signalen an den
Ausgängen (Pin 15 bis Pin 17) des Controllers die drei
Endstufentransistoren (T 1 bis T 3) für die LEDs angesteuert. Über die
PWM (Pulsweitenmodulation) wird somit die Helligkeit der einzelnen
Farb-LEDs vom Controller festgelegt. Durch die Mischung der drei
Grundfarben ergibt sich ein Farbverlauf, wie er in Abbildung 3 zu sehen
ist. Zum Anschluss der externen LED-Stripes steht die Buchse BU 2 zur
Verfügung, eine passende Schraubklemme ist dem Bausatz beigelegt. Jeder
Kanal ist mit einem maximalen Strom von 0,5 A belastbar. Über die beiden
Transistoren T 4, T 5 und die Widerstände R 13 bis R 16 ist der
Mikrocontroller in der Lage, die RGB-LEDs auf der Zusatzplatine einzeln
abzuschalten. An den Pins 6 und 7 des Mikrocontrollers IC 2 befinden
sich die beiden Taster TA 1 und TA 2. Über diese beiden Taster ist die
komplette Bedienung des WST 100 möglich.Nachbau
Auf
der Basisplatine und der LEDPlatine sind bereits alle SMD-Bauteile
vorbestückt. Dies erspart den Umgang mit den mitunter nicht leicht zu
handhabenden SMD-Bauteilen. Dennoch ist die Bestückung wie üblich auf
Bestückungsfehler, Lötzinnbrücken und vergessene Lötstellen zu prüfen.
Die Bestückung der restlichen Bauelemente erfolgt in gewohnter Weise
anhand des Bestückungsplans, der Stückliste und unter Zuhilfenahme der
Platinenfotos. Bei der Displayplatine sind nur die beiden 12-poligen
Stiftleisten ST 1 und ST 2 und das Display LCD 1 zu bestücken. Hierbei
ist auf die richtige Platzierung des Displays zu achten. Das Display
besitzt eine kleine Glasnase, die auch im Bestückungsdruck zu finden
ist. Hier wie bei den Stifleisten, welche von der Lötseite zu bestücken
sind, ist auf planes Einlöten zu achten, um später einen exakten
Zusammenbau des Gerätes realisieren zu können. Auch der Zusammenbau der
LED-Platine gestaltet sich sehr einfach. Nach dem Anlöten der beiden
3-poligen Stiftleisten ST 3 und ST 4, die ebenfalls von der Lötseite
bestückt werden, kann die LEDAbdeckung aufgesetzt werden. Auch hier
zeigt der Bestückungsdruck an, wo sich die abgeschrägte Seite der
Abdeckung befinden muss. Um die LED-Abdeckung an die Platine zu
fixieren, können die Stege entweder geklebt oder mit Hilfe des
Lötkolbens erwärmt und umgebogen werden. Widmen wir uns nun der
Basisplatine. Als Erstes ist der HF-Empfänger mit dem beigefügten
Silberdraht an die entsprechenden Lötflächen auf der Basisplatine
anzulöten. Beim anschließenden Einsetzen und Verlöten der Elkos C 1, C
4, C 9 und C 11 ist auf die richtige Polarität zu achten (Elkos sind am
Minus-Pol gekennzeichnet). Die Buchsen BU 1, BU 2 und die Taster TA 1
und TA 2 sind plan und sauber ausgerichtet zu bestücken und deren
Anschlüsse mit reichlich Lötzinn zu verlöten. Danach folgt der
Temperatursensor TS 1 (ungepolt). Zum Schluss sind noch die
Buchsenleisten ST 1 bis ST 4 zu verlöten. Diese sind ebenfalls plan zu
bestücken. Damit ist die Bestückung der Platinen abgeschlossen, sie sind
jetzt nochmals auf Bestückungsfehler, vergessene Bauelemente und
Lötfehler zu kontrollieren. Nach dieser abschließenden Kontrolle werden
die Displayplatine und die LEDPlatine auf die vorgesehenen
Buchsenleisten gesteckt. Dabei zeigen die Nase des Displays sowie die
abgeschrägte Seite der LED-Abdeckung jeweils in Richtung der Taster TA 1
und TA 2.Inbetriebnahme
Nach
dem Anlegen der Spannungsversorgung führt das WST 100 einen Displaytest
durch, wobei alle Segmente des Displays für eine Sekunde angezeigt
werden. Anschließend wird die aktuelle Temperatur des eingestellten
Sensors angezeigt, sofern das WST 100 ein Datenpaket empfangen hat.
Solange kein Datenpaket auf der Sensoradresse empfangen worden ist,
zeigt das WST 100 auf dem Display zwei waagerechte Striche an. Bei
Auswahl des internen Temperatursensors (S0) erfolgt natürlich eine
sofortige Anzeige. Nun kann man nach Bedarf entsprechend dem Abschnitt
„Bedienung“ die Anzeige konfigurieren.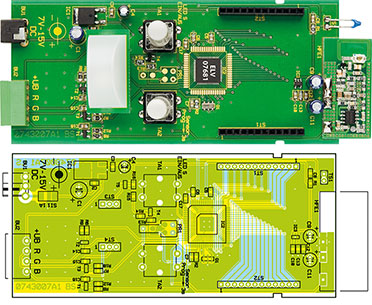
|
| Ansicht der fertig bestückten Basisplatine des WST 100 mit zugehörigem Bestückungsplan |
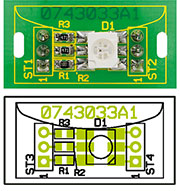
|
| Ansicht der fertig bestückten LEDPlatine des WST 100 mit zugehörigem Bestückungsplan |
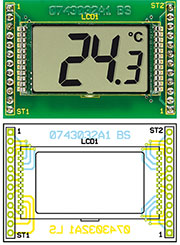
|
| Ansicht der fertig bestückten Displayplatine des WST 100 mit zugehörigem Bestückungsplan |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (5 Seiten)
als PDF (5 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Wetterstations-Templight WST 100 – Ein Blick genügt!
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo










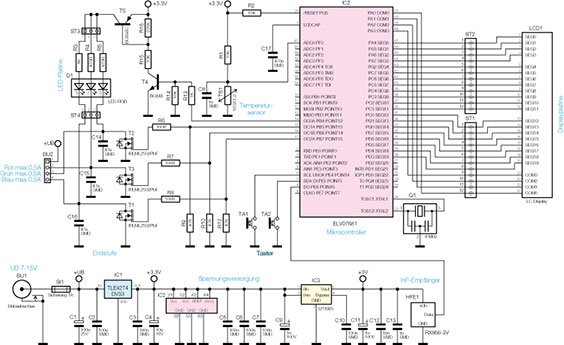
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (5 Seiten)
als PDF (5 Seiten)