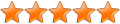Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
- FAQ-Datenbank
- Batterien, Akkus, Ladegeräte
- Bausätze, Lernpakete, Literatur
- Beleuchtung
- Computer-/Netzwerktechnik
- Electronic Components
- Hausautomation - Smart Home
- Haustechnik
- Kfz-Elektronik
- Klima-Wetter-Umwelt
- Messtechnik
- Modellsport, Freizeit
- Multimedia-SAT-TV
- Netzgeräte, Wechselrichter
- Sicherheitstechnik
- Telefon-/Kommunikationstechnik
- Werkstatt, Labor
- Ratgeber
- Batterien - Akkus - Ladegeräte
- Bausätze
- Beleuchtung
- Computer-/Netzwerktechnik
- Electronic-Components
- Freizeit- und Outdoortechnik
- Hausautomations-Systeme
- Haustechnik
- Kfz-Technik
- Klima - Wetter - Umwelt
- Messtechnik
- Multimedia - Sat - TV
- Netzgeräte - Wechselrichter
- Sicherheitstechnik
- Telefon-/Kommunikationstechnik
- Werkzeug - Löttechnik
- Elektronikwissen
- So funktioniert´s
- Praxiswissen
- FAQ-Datenbank
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
- ELVintern
- Experten testen
- Praxiswissen
- So funktioniert´s
- Hausautomation - Smart Home
- Haustechnik
- Beleuchtung
- Sicherheitstechnik
- Klima - Wetter - Umwelt
- Computer/Netzwerk
- Multimedia - Sat - TV
- Telefon - Kommunikation
- Kfz-Technik
- Stromversorgung
- HomeMatic-Know-how
- Freizeit- und Outdoortechnik
- Werkzeug - Löttechnik
- Messtechnik
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo
Kfz-Leistungsmesser KL 100 - Zeigt, was in Ihrem Motor steckt Teil 4/4

 |  |  |  |
| 1 | 1 | OK | 5/2007 |
Inhalt des Fachbeitrags
Der KL 100 ermittelt anhand eines elektronischen Tachosignals, das bei vielen Pkw bereits bis zum Autoradio-Einbauschacht gelegt ist, die Fahrzeuggeschwindigkeit und die Beschleunigungsdaten des Fahrzeugs. Nach Eingabe der Fahrzeugmasse und einer Messfahrt kann das Gerät die Motorleistung bestimmen. Es laufen Kilometerzähler und unter Berücksichtigung der Reibung auch Energiezähler mit, die Rückschlüsse auf das Fahrverhalten ziehen lassen. Die Messwerte und Einstellungen lassen sich über ein LC-Display verwalten. Im vierten Teil stellen wir die Datenlogger- Funktion des KL 100 vor, befassen uns mit der PC-Software und diskutieren ausführlich Anwendungsbeispiele.
Der Datenlogger
Der
integrierte Datenlogger des KL 100 gibt dem Fahrer die Möglichkeit,
alle für die spätere Auswertung relevanten Daten aufzuzeichnen und in
Ruhe am PC auszuwerten. Er speichert bis zu 16.896 Einträge, bestehend
aus:
- Zeitstempel „t“ in Sekunden
- Geschwindigkeit „v“ in km/h
- Beschleunigung „a“ in mm/s²
- Kilometerzähler für die aktuelle Fahrt „s“ in km
Das Aufzeichnungsintervall ist einstellbar von 1 bis 90 Sekunden, damit sind z. B. folgende Aufzeichnungslängen erreichbar:
- Speicherkapazität bei 1 Sek.: ca. 4,7 Stunden
- Speicherkapazität bei 90 Sek.: ca. 17,6 Tage
Wenn der Speicher voll ist, werden die jeweils ältesten Daten überschrieben (Ringspeicher). Um auch die Möglichkeit offenzuhalten, das Gerät als eine Art elektronisches Fahrtenbuch einsetzen zu können, ist ein Löschen der Daten durch den Benutzer nicht möglich. Praktische Einsatzfälle für die Nutzung des Datenloggers wären etwa das Aufzeichnen von Fahrten zum Protokollieren, das Aufzeichnen von Mess-Fahrten, z. B. zum Feststellen von Motorleistung oder Verlustleistung, aber auch das Aufzeichnen von Fahrten zur Überwachung anderer Fahrzeugnutzer. Letzteres kann, je nach Auswerteabsicht, offen oder verdeckt erfolgen. Zwei Beispiele sollen diese Möglichkeit erläutern:
Wenn der Nachwuchs sich das Familienauto leiht …
Hier kann der KL 100, insbesondere, wenn der Führerschein noch „frisch” ist, quasi als mäßigender elektronischer Beifahrer agieren. Der Fahrer weiß, dass der KL 100 die Fahrt aufzeichnet, und muss sich daher an die Regeln halten. Das heimliche Abschalten der Datenlogger-Funktion führt dazu, dass die Fahrt in den Aufzeichnungen fehlt, das Abschalten wird so entdeckt. Das Manipulieren der Einstellung für das Tachosignal kann allerdings nur anhand eines Soll-Ist-Vergleichs der Streckenlänge entdeckt werden. Aber man muss dem Sohnemann ja nicht alles erläutern …
Einstellungen am KL 100 zur Aktivierung des Datenloggers
 |
| Bild 13: Datenlogger-Menü |
Der Zeitzähler wird immer auf null zurückgesetzt, wenn:
- der KL 100 aus- und wieder eingeschaltet wird,
- das Intervall editiert wird,
- im Datenlogger-Menü die Taste „Messung“ gedrückt wird.
Letzteres ist hilfreich, wenn man einen bestimmten Abschnitt einer Messfahrt markieren möchte, damit die Messfahrt als separate Fahrt gespeichert wird und später in den aufgezeichneten Daten besser wiederzufinden ist.
Die PC-Software
Dem KL 100 liegt eine CD-ROM bei, auf der sich der USBTreiber, die PC-Software zum Auslesen der aufgezeichneten Daten aus dem KL 100 und ein paar Beispieldateien für das weitere Verarbeiten der Daten im Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel befinden. Die Systemvoraussetzungen für das Programm und den Anschluss des KL 100: Microsoft-Windows-Betriebssystem ab 2000, optisches Laufwerk und ein freier USB-Port.Die Programminstallation
Nach dem Einlegen der CD-ROM startet die Programminstallation automatisch. Ist die Autostart-Funktion des Betriebssystems deaktiviert, ist auch ein manueller Start der Installation durch Ausführen der Datei „Setup_KL100.exe“ auf der CD-ROM möglich. Die Installation ist schnell erledigt, man muss nur einigen Anweisungen des Programms folgen.Die Bedienung von Programm und KL 100
Zum Auslesen der aufgezeichneten Daten aus dem KL 100 muss dieser über das mitgelieferte USB-Kabel an den PC angeschlossen werden, nachdem er von der Bordstromversorgung des Fahrzeugs getrennt wurde. Da der KL 100 beim Anschluss an den PC über die USB-Verbindung mit Spannung versorgt wird, kann ein gleichzeitiger Anschluss an das Kfz- Bordnetz zu Beschädigungen führen. Bei ordnungsgemäßem Anschluss an den PC erscheint im Display des KL 100 „USB“. In dieser Betriebsart sind alle anderen Funktionen des KL 100 deaktiviert. |
| Bild 14: Das PC-Programm hat den KL 100 erkannt und ist bereit, die Daten auszulesen und im PC zu speichern. |
Verarbeiten der Daten in Excel
Die PC-Software speichert die Daten im „.csv“-Format mit Semikolons als Trennzeichen. Diese Dateien können mit Excel geöffnet und weiterverarbeitet werden. Die Datei ist so aufgebaut, dass die zuletzt gespeicherte Fahrt ganz oben in der Liste steht. Der erste Eintrag ist jedoch nicht der zuletzt gespeicherte Eintrag, sondern der Eintrag mit dem Zeitstempel null, also der erste Eintrag der Fahrt. Nach dem Ergänzen von Formeln oder Diagrammen sollte man die Datei im „.xls“-Format speichern, damit die Änderungen nicht verloren gehen.Gemessene Leistung
Die gemessene Leistung PMessung, also die Leistung entsprechend gemessener Beschleunigung, errechnet sich gemäß:
PMessung=FKL100*vKL100/3,6/1000
Das Teilen durch 3,6 rechnet die Geschwindigkeit von km/h in m/s um, das Teilen durch 1000 rechnet die Leistung von W in kW um. Zuvor wird berechnet:
FKL100=Masse*aKL100/1000
Dabei wird die Beschleunigung von mm/s² umgerechnet in m/s², also durch 1000 geteilt.
Errechnete Verlustleistung
Mit der errechneten Verlustleistung ist die Leistung gemeint, die der KL 100 als Grundlage für die angezeigten Messwerte verwendet. Der KL 100 berechnet diese Leistung unter Zuhilfenahme der eingestellten Faktoren L für den Luftwiderstand und R für den Rollwiderstand. Zum Nachrechnen dieser Werte in Excel werden die folgenden Formeln verwendet:
PReibung=FReibung*vKL100/3,6/1000
Die Divisionen sind wie zuvor beschrieben zum Umrechnen der Einheiten erforderlich.
FReibung=-(L*POTENZ(vKL100;2)+R*Masse)/1000
Der Faktor L ist so definiert, dass er sich auf die Geschwindigkeit in km/h bezieht, es wird hier also nicht in m/s umgerechnet. Die Einheit von FReibung ist letztendlich N.
Praktische Auswertungs-Beispiele
Die Excel-Dateien der folgenden Beispiele befinden sich auf der CD-ROM im Verzeichnis „examples“.Motorleistung
 |
| Bild 15: Beispiel Leistungsdiagramm |
 |
Verlustleistung
Für dieses Beispiel haben wir zwei Ausroll-Aufzeichnungen gemacht, eine bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn, die andere bei niedrigen Geschwindigkeiten auf der Landstraße, und diese aneinandergehängt. Das Ergebnis ist eine zweiteilige Leistungskurve, die die Reibungsverluste abhängig von der Geschwindigkeit über einen weiten Geschwindigkeitsbereich zeigt. An dieser Kurve kann man nun direkt ablesen, welche Motorleistung gebraucht wird, um das gemessene Kfz konstant auf der zugehörigen Geschwindigkeit zu halten. Über diese Kurve haben wir noch eine Kurve mit der errechneFür dieses Beispiel haben wir zwei Ausroll-Aufzeichnungen gemacht, eine bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn, die andere bei niedrigen Geschwindigkeiten auf der Landstraße, und diese aneinandergehängt. Das Ergebnis ist eine zweiteilige Leistungskurve, die die Reibungsverluste abhängig von der Geschwindigkeit über einen weiten Geschwindigkeitsbereich zeigt. An dieser Kurve kann man nun direkt ablesen, welche Motorleistung gebraucht wird, um das gemessene Kfz konstant auf der zugehörigen Geschwindigkeit zu halten. Über diese Kurve haben wir noch eine Kurve mit der errechneten Verlustleistung gelegt. Dazu werden wie oben beschrieben die Faktoren L und R benötigt, die man z. B. im Menü des KL 100 ablesen kann. Wenn sich die Kurven decken, sind die Faktoren L und R optimal eingestellt. Wenn nicht, kann man nun direkt in Excel die Faktoren so verändern, bis sich die Kurven decken, und die so ermittelten Faktoren L und R wiederum in den KL 100 eingeben. Die Kurve der errechneten Verlustleistung sagt nun auch vorher, wie viel Motorleistung für höhere Geschwindigkeiten gebraucht wird. |
| Bild 16: Beispiel Verlustleistung |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version
als Online-Version als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:
- Kfz-Leistungsmesser KL 100 - Zeigt, was in Ihrem Motor steckt Teil 4/4
- 1 x Journalbericht
| weitere Fachbeiträge | Foren |