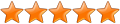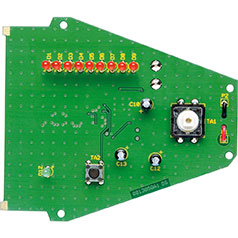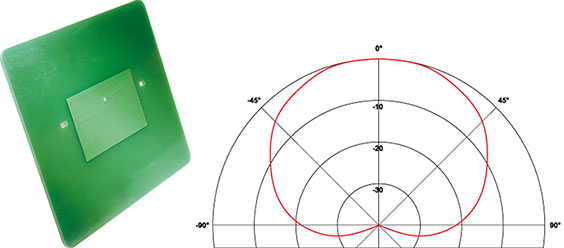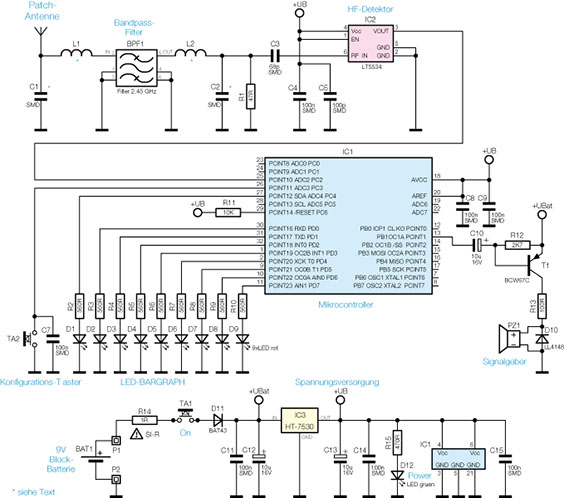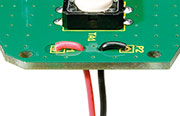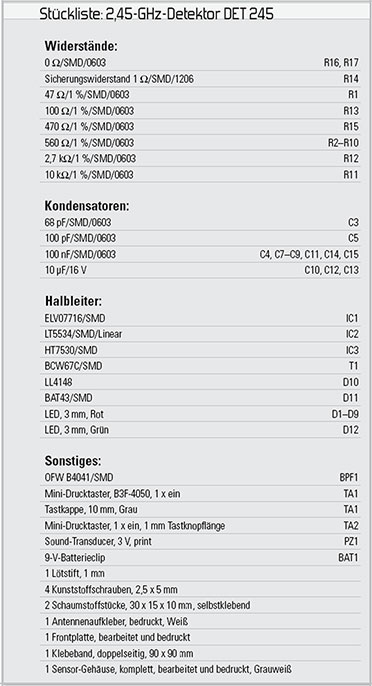Aufgespürt - 2,45-GHz-Fetektor DET 245 (Detektiv für Funk-Kamerasysteme und WLAN-Sender)
Technische Daten
| Spannungsversorgung | 9-V-Blockbatterie 6LR61 |
| Frequenz | 2,45 GHz |
| Stromaufnahme | 60 mA |
| Freifeldreichweite | bis 5 m |
Funk-Kamerasysteme,
WLAN-Netze, Bluetooth-Geräte, A/V-Sender u. a. arbeiten auf
unterschiedlichen
Frequenzen und mit unterschiedlichen Modulationsverfahren im
lizenzfreien ISM-2400-Frequenzband. Der 2,45-GHz-Detektor ist ein
mobiles Hand-Gerät zum Detektieren solcher Sender und ihres Standortes.Finden und orten
Das
2,4-GHz-Band umfasst den Frequenzbereich von 2,400 bis 2,4835 GHz, es
ist von der ITU als sogenanntes ISM-Band für die lizenzfreie Nutzung
durch Short Range Devices (SRD, Funksender geringer Leistung)
freigegeben. Der Name ISM (Industrial Scientific and Medical) sagt es:
dieses Frequenzband kann durch ganz unterschiedliche Anwendungen belegt
werden. Die Lizenzfreiheit der hier betriebenen Funkgeräte besagt zwar,
dass jeder, ohne eine Funklizenz zu beantragen, mit diesen Geräten
arbeiten kann, allerdings ist die technische Konzeption der Sende- und
Empfangsgeräte einigen Konventionen unterworfen. So dürfen je nach
Geräteart bestimmte HF-Leistungen nicht überschritten werden, andere
Systeme wie WLAN oder Bluetooth unterliegen besonderen Normungen, um die
Zusammenarbeit von Geräten unterschiedlicher Hersteller zu
gewährleisten und die Nutzung des zugewiesenen Frequenzbereiches
effektiv zu gestalten.Leider
hat die allgemein freigegebene Nutzung solcher Bänder vor allem einen
Haken – die Anzahl der Kanäle ist naturgemäß begrenzt und so sind
gegenseitige Störungen, wenn vielleicht auch nur kurzzeitig, weil einige
Systeme mit Frequenzhopping arbeiten, trotz nominell geringer
Reichweiten vorprogrammiert. Ein A/V-Sendesystem ist also kaum
ununterbrochen störungsfrei zu betreiben, wenn man im Empfangsbereich
des A/V-Empfängers ein Bluetooth-Handy betreibt oder gar ein WLAN im
gleichen Haus nutzt. Und die geringe Leistung sowie die hohe Frequenz
haben auch dazu geführt, dass die Sende- und Empfangstechnik immer
kompakter wird. 
|
| Bild
1: 2,4-GHz-Sendesysteme sind extrem kompakt realisierbar und somit auch
gut unauffällig zu installieren. Links ein komplettes
Mini-Kamera-Sendersystem, rechts ein Mini-WLAN-Sender, in der Mitte ein
Bluetooth-Stick, der sogar noch einen Speicherkartenleser enthält.
Besonders Geräten wie letzterem Bluetooth-Stick sieht man seine
Hauptfunktion zunächst nicht an. |
Dies
und die angestrebte universelle Einsetzbarkeit für alle ISM-Dienste
bedingen ein Messgerät, mit dem der Sender möglichst punktgenau geortet
werden kann. Das muss nicht extrem empfindlich in Bezug auf
Empfangsreichweite sein, aber über eine möglichst hohe Richtwirkung
verfügen, um tatsächlich punktgenau einen Sender finden zu können und
nicht etwa einen anderen im Nachbarhaus damit anzupeilen. Die Anwendung
eines solchen Gerätes kann vielfältig sein – es kann zur Störungssuche
genauso eingesetzt werden wie zum Optimieren und Abstimmen verschiedener
2,45-GHz-Systeme, aber auch zur o. a. Suche nach versteckten Sendern.
Es ist auch sehr nützlich für das Aufspüren verbotenerweise eingesetzter
WLAN- und Bluetooth-Geräte in Betrieben, denn deren Einsatz ist im
Allgemeinen streng reglementiert, um die Daten- und
Kommunikationssicherheit in einer Firma zu gewährleisten. Ein
unerlaubter, offener WLAN-Port kann fatale Folgen für die
Datensicherheit haben! Unser hier vorgestellter 2,45-GHz-Detektor kann
genau diese Aufgaben erfüllen. Er verfügt über eine sehr wirksame
Richtantenne, die Feldstärkeanzeige erfolgt sowohl optisch als auch
akustisch. Durch die extrem einfache Bedienung ist die Nutzung des
Gerätes für jedermann möglich. Funktion
Um
die exakte Position einer Signalquelle mit dem 2,45-GHz- Detektor
aufzuspüren, ist eine Antenne mit einem gutem Vor- Rück-Verhältnis und
hoher Richtwirkung erforderlich. Aus diesen Gründen kommt hier eine
Patch-Antenne zum Einsatz. Eine solche Patch-Antenne ist sehr einfach
aufzubauen und kostengünstig zu produzieren. Sie besteht lediglich aus
einer doppelseitigen Platine.Abbildung 2 zeigt die verwendete Patch-Antenne des 2,45-GHz-Detektors mit einem beispielhaften Richtdiagramm. 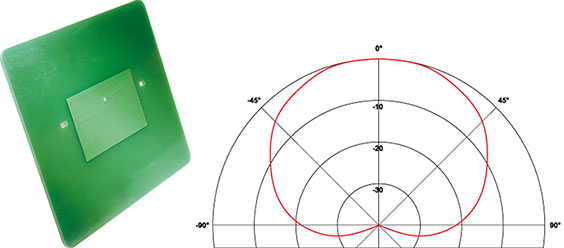
|
| Bild 2: Patch-Antenne mit beispielhaftem Richtdiagramm |
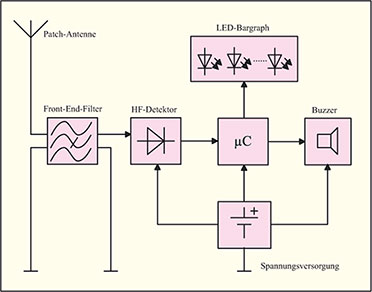
|
| Bild 3: Blockschaltbild des 2,45-GHz-Detektors |
Schaltungsbeschreibung
Die Schaltung (Abbildung 4) wird mit einer 9-V-Blockbatterie BAT 1 betrieben.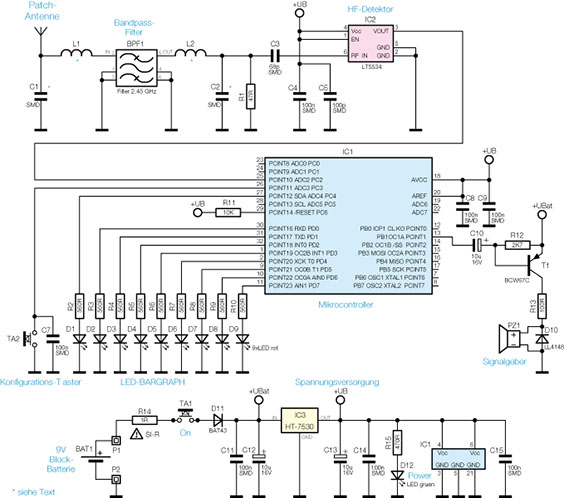
|
| Bild 4: Schaltbild des 2,45-GHz-Detektors |
Der
Spannungsregler IC 3 stabilisiert die Batteriespannung auf 3 V. Die
Kondensatoren C 11 bis C 14 dienen zur Unterdrückung der Schwingneigung
des Spannungsreglers. Mit dem On-Taster TA 1 wird das Gerät
eingeschaltet. Das bedeutet, dass das Gerät nur so lange in Betrieb ist,
wie der Taster gedrückt und gehalten wird. Die Diode D 11 dient als
Verpolungsschutz und der Widerstand R 14 als Sicherungselement. Die
Leuchtdiode D 12 dient in Verbindung mit dem Vorwiderstand R 15 als
Betriebsanzeige. Fast die gesamte Schaltung wird mit der stabilisierten
Betriebsspannung von 3 V versorgt. Ausgenommen ist der Signalgeber PZ 1.
Er wird direkt mit der 9-V-Batteriespannung versorgt, um eine maximale
Lautstärke zu erreichen. Das Eingangssignal gelangt über die
Patch-Antenne zum Bandpassfilter BPF 1. Das Filter hat eine
3-dB-Bandbreite von 100 MHz und selektiert somit das gesamte Frequenz-
Band von 2400 MHz bis 2484 MHz (ISM 2400). Nach
der Filterung wird das Signal dem HF-Detektor IC 2 zugeführt. Er
wandelt das HF-Signal in eine Gleichspannung um. Dabei ist die Höhe der
Gleichspannung abhängig vom Leistungspegel des HF-Signals. Die
Induktivitäten L 1, L 2 und die Kondensatoren C1, C 2 dienen zur
Anpassung der Antenne und des HF-Detektors IC 2 an das Bandpassfilter
BPF 1. Da die Patch-Antenne für eine Eingangsimpedanz von 50 Ω ausgelegt
ist und das Bandpassfilter BPF 1 ebenfalls eine Ein- und
Ausgangsimpedanz von 50 Ω hat, konnte auf eine Anpassung an dieser
Stelle verzichtet werden. Das bedeutet, die Kondensatoren C 1 und C 2
sind nicht bestückt und die Induktivitäten L 1 und L 2 werden durch
0-Ω-Widerstände ersetzt. Der Widerstand R 1 ist das einzige
Anpass-Element und verbessert die Rückflussdämpfung des HF-Detektors um
ca. 10 dB. Die Kondensatoren C 4 und C 5 dienen zum Abblocken der
Betriebsspannung des HF-Detektors IC 2. Der
8-Bit-Mikrocontroller IC 1 von Atmel übernimmt die Auswertung des
Ausgangssignals VOUT des HF-Detektors IC 2. Er wandelt mit Hilfe seines
internen 10-Bit-Analog-Digital- Wandlers ADC2 die analoge Gleichspannung
in ein digitales Datenwort. Nach der Auswertung des Datenwortes werden
dann die entsprechenden Leuchtdioden D 1 bis D 9 über die Ports PC 4 und
PD 0 bis PD 7 angesteuert. Die Widerstände R 2 bis R 10 dienen zur
Strombegrenzung der Leuchtdioden. Zusätzlich wird mit dem Port PB 1 über
den Transistor T 1 der Signalgeber PZ 1 angesteuert. Der Transistor
dient dabei in Verbindung mit dem Widerstand R 12 als Treiber für den
Signalgeber PZ 1. Je nach Stärke des Eingangssignals wird eine Frequenz
zwischen 40 Hz und 500 Hz erzeugt. Der Widerstand R 11 sorgt für einen
definierten Reset des Mikrocontrollers IC 1 beim Zuschalten der
Betriebsspannung. Um eine optimale Performance des 2,45-GHz-Detektors zu
erreichen, ist eine Einstellung der Empfindlichkeits-Schwelle
erforderlich. Diese wird bei der ersten Inbetriebnahme mit dem Taster TA
2 durchgeführt (siehe Bedienung/Abgleich). Nachbau
Alle
SMD-Bauteile sind bereits bei der Auslieferung des Bausatzes bestückt.
Es müssen lediglich die bedrahteten Bauteile eingelötet werden. Dazu
zählen drei Kondensatoren, Elkos, ein Taster, der Signalgeber, 10
Leuchtdioden, ein Lötnagel und ein Batterieclip. Außerdem sind die
Basisplatine und die Patch-Antenne miteinander zu verlöten. Alle
Bauteile bis auf den Signalgeber und der Lötnagel sind von der
Platinenoberseite der Basisplatine zu bestücken und anschließend von der
Unterseite zu verlöten. Bei den Elkos ist die Polung zu beachten.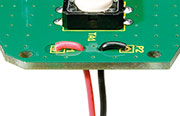
|
| Bild 6: Basisplatine mit Batterieclip-Anschlüssen |
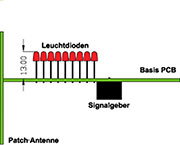
|
| Bild 5: Seitenansicht der Basisplatine des 2,45-GHz-Detektors |
Bevor
nun die komplett bestückte Basisplatine mit der Patch- Antenne verlötet
werden kann, muss der Lötnagel präpariert werden. Dazu ist der Lötnagel
von der Rückseite in die dafür vorgesehene Bohrung der Patch-Antenne zu
stecken und so zu kürzen, dass er nicht mehr aus der Platine
herausragt. Dann kann der Lötnagel mit der Patch-Antenne verlötet
werden. Anschließend ist die Patch-Antenne auf die Basisplatine zu
schieben, so dass die beiden Platinen senkrecht zueinander stehen, und
zu verlöten. Zum Schluss muss der Lötnagel mit wenig Lötzinn auf die
Leiterbahn der Basisplatine gelötet werden. Dabei ist zu beachten, dass
der Lötnagel flach auf der Leiterbahn aufliegt. Jetzt sind alle
Lötarbeiten abgeschlossen. Als Nächstes ist der mitgelieferte Aufkleber
direkt über das Patch der Antenne zu kleben. 
|
| Bild 7: Patch-Antenne |
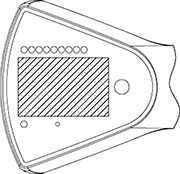
|
| Bild 8: Gehäuseoberschale des 2,45-GHz-Detektors |

|
| Bild 9: Das fertig aufgebaute Gerät |
Bedienung/Abgleich
Vor
der Inbetriebnahme ist eine Einstellung der Empfindlichkeitsschwelle
vorzunehmen, um eine hohe Empfindlichkeit und somit eine optimale
Reichweite zum Aufspüren von ISM-Geräten zu erreichen. Dies ist
erforderlich, um z. B. in Räumen mit einer hohen Deckenhöhe eine
erfolgreiche Suche durchzuführen. Sollte diese Einstellung nicht
vorgenommen werden, ist automatisch eine mittlere
Empfindlichkeitsschwelle voreingestellt.Die Einstellung ist wie folgt durchzuführen:
•
Mit einem dünnen Gegenstand, z. B. einer Büroklammer, den Taster TA 2
durch die dafür vorgesehene Bohrung in der Frontplatte gedrückt halten.
•
Taster „On“ betätigen und ebenfalls gedrückt halten. Jetzt wird
automatisch ein Leuchtdioden-Test durchgeführt, d. h., alle Leuchtdioden
werden in Form eines Lauflichtes von unten nach oben hin angesteuert.
Zusätzlich ertönt ein Ton vom Signalgeber. Anschließend beginnt der
Einstellvorgang für die Empfindlichkeitsschwelle des Gerätes. Dazu
werden die Leuchtdioden im Halbsekundentakt angesteuert. Das bedeutet,
je mehr LEDs leuchten, desto empfindlicher ist der 2,45-GHz-Detektor.
Die Bestätigung der gewünschten Empfindlichkeit erfolgt durch das
Loslassen des Tasters TA 2. Ein Signalton bestätigt das Abspeichern der
gewünschten Schwelle. Zusätzlich wird die eingestellte
Empfindlichkeitsschwelle mit der entsprechenden Leuchtdiode
signalisiert. Dies wird ebenfalls bei jeder Inbetriebnahme angezeigt.
• Taster „On“ loslassen
Nach
dem Abgleich kann der 2,45-GHz-Detektor zum Einsatz kommen, um z. B.
die besprochenen Funk-Kamerasysteme und bedingt auch WLAN-Router
aufzuspüren. Dazu ist, wie bei der Einstellung der
Empfindlichkeitsschwelle, der Taster „On“ zu drücken und festzuhalten.
Sobald man den Taster loslässt, schaltet sich das Gerät wieder aus. 9
rote Leuchtdioden zeigen im Betrieb die mit der Patch-Antenne empfangene
relative Signalstärke an. Je mehr Leuchtdioden leuchten, desto stärker
ist das empfangene Signal. Um die Anzeige besser beurteilen zu können,
ist es erfor derlich, sich mit dem Gerät sehr langsam zu bewegen. Sich
dabei einmal um die eigene Achse zu drehen ist sehr hilfreich, um die
Richtung eindeutig zu bestimmen. Eine akus tische Anzeige unterstützt
zusätzlich das Suchen der Geräte. Das bei geringer Feldstärke hörbare
„Knattern“ verändert sich mit stärker werdender Signalstärke in einen
Ton mit steigender Frequenz. Das unterstützt die visuelle Suche nach dem
georteten Gerät. 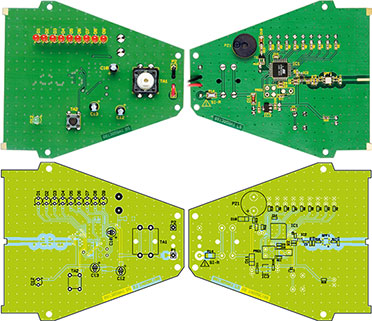
|
| Ansicht
der fertig bestückten Platine des DET 245 mit zugehörigem
Bestückungsplan, links von der Bestückungsseite, rechts von der Lötseite |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (6 Seiten)
als PDF (6 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Aufgespürt - 2,45-GHz-Fetektor DET 245 (Detektiv für Funk-Kamerasysteme und WLAN-Sender)
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Kommentare:
05.04.2013 schrieb Gerald Grummt:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
gern würde ich diesen Bausatz bestellen (2,45-GHz-Fetektor DET 245) und
aufbauen, leider finde ich aber keine Artikelnummer dazu. Gibt es einen
Grund, warum der BS nicht mehr bestellbar ist ? Vielleicht ist auch ein
Nachfolger-Projekt geplant ?
Ich habe eine weitere Anfrage zum Thema Radar-Sensoren. Derzeit wird in
der Politik gerade über eine Freigabe von Radarwarnern diskutiert.
Sollte hier tatsächlich eine Freigabe erteilt werden, würde ich mich
ebenfalls sehr über einen Bausatz zu diesem Thema freuen.
Mit freundlichen Gruessen,
Gerald Grummt”
16.04.2013 schrieb Michael Sandhorst (Technik):
„Hallo Gerald Grummt,
im Produktlebeneszyklus müssen unsere Produktmanager an einem gewissen
Punkt entscheiden, ob wir das Sortiment aus vielerlei Gründen (z.B.
Nachfrage, limitierte Lagerkapazität) ändern oder nicht. In diesem Fall
haben die Verantwortlichen eine Auslistung entschieden. Derzeit können
wir Ihnen aus unserem aktuellen Liefersortiment auch keinen Nachfolger
mit gleichen Produkteigenschaften anbieten.
Wir bedauern Ihnen keine andere Mitteilung machen zu können.
Mit freundlichen Grüßen Michael Sandhorst (Technik)
”
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo






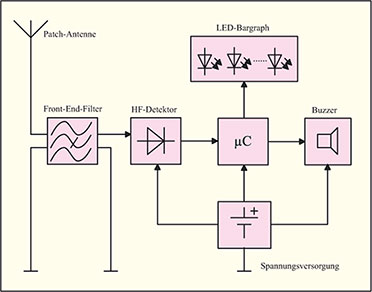
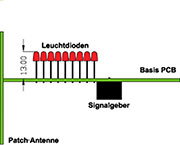

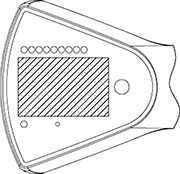
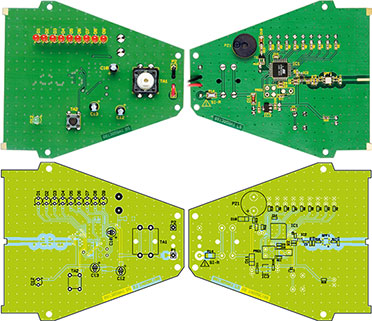
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (6 Seiten)
als PDF (6 Seiten)