Ökonomisch heizen – Wärmebedarfsrelais FHT 8W Teil 2/2
Aus ELVjournal
02/2008
0 Kommentare
Heizen genau nach Bedarf
Das
Wärmebedarfsrelais unterstützt den ökonomischen Betrieb einer
Heizungsanlage, indem es die Funk-Kommunikation zwischen den
ELV-Raumreglern und den zugehörigen Stellantrieben auswertet und per
einstellbaren Kriterien z. B. Umwälzpumpen oder sogar den Brenner der
Heizung je nach tatsächlichem Wärmebedarf schaltet. Damit vermeidet man
unnötigen Heizenergie- und Stromverbrauch und spart wieder einiges an
Energiekosten.
Nach der Vorstellung des Gerätes und seiner Bedienung und Programmierung
sowie Einbindung in die Heizungsanlage im ersten Teil kommen wir
zunächst zur Schaltung des Gerätes.Schaltung
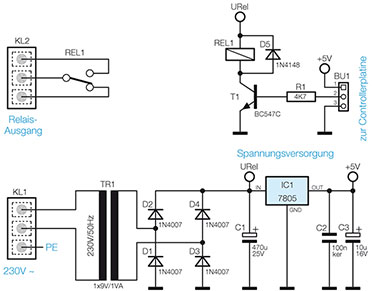
|
| Bild 5: Die Schaltung von Netzteil, Schaltstufe und Relais-Schaltkontakt |
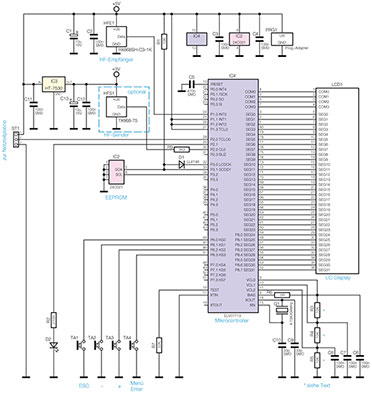
|
| Bild 6: Die Schaltung des Controller-Teils mit Display, EEPROM und Sende-/Empfangsteil |

|
| Bild
7: Alle Segmente des verwendeten Displays. Sie erscheinen so nur im
Einschaltmoment zum Selbsttest und werden in dieser Applikation nicht
alle genutzt. |
Nachbau
Der
Nachbau der Controllerplatine gestaltet sich besonders einfach, da
diese werkseitig bereits weitestgehend bestückt und getestet ist.
Einzulöten ist lediglich noch die Stiftleiste ST 1. Diese ist mit den
kurzen Stiftenden von der Unterseite her in die Leiterplatte einzusetzen
und von der Oberseite zu verlöten. Hierbei ist auf eine senkrechte
Ausrichtung zu achten, damit die Stiftleiste später beim Gehäuseeinbau
problemlos in die Buchsenleiste passt. Soll die FS20-Funkstrecke
genutzt werden, so ist außerdem ein Sendemodul vom Typ TX868-75 an der
Position HFS 1 zu bestücken. Es wird von der Oberseite her in die
Leiterplatte eingesetzt und angelötet. Das Modul sollte hierbei nicht
aufliegen, sondern in einem Abstand von 5 mm zur Leiterplatte montiert
werden. An mechanischen Komponenten sind auf der Controllerplatine dann
noch die 4 Tasterstößel und die 3 Antennenhalter anzubringen. Letztere
sind zuvor an der vorhandenen Sollbruchstelle zu kürzen. Hierbei
verbleibende Grate sollten entfernt werden, damit die Bauhöhe von 10 mm
zwischen Leiterplatte und Abdeckplatte nicht überschritten wird. Die
Position, an der die Halter bis zum Einrasten auf die Kante der
Leiterplatte zu schieben sind, ist aus dem Bestückungsdruck und den
Bestückungsfotos leicht ersichtlich. Die Antenne ist dann nur noch durch
die Löcher der Halter zu fädeln.
Im Gegensatz zur Controller-Leiterplatte ist die Basis-Leiterplatte
nicht vorbestückt. Der Nachbau gestaltet sich aber auch hier sehr
einfach, da keine miniaturisierten SMD-Komponenten zu bestücken sind,
sondern ausschließlich konventionelle, bedrahtete Bauteile. Dies
geschieht in der bewährten Reihenfolge, beginnend mit den niedrigsten
Komponenten, gefolgt von den jeweils nächst höheren. Insbesondere bei
den Dioden und Elektrolyt-Kondensatoren ist auf die korrekte Einbaulage
bzw. Polarität zu achten. Die Kühlfläche von IC 1 muss zur
Platinenaußenkante weisen. Außerdem ist dieser Spannungsregler so
niedrig wie möglich zu bestücken, d. h. mit der „Verdickung“ der
Anschlussbeine auf der Leiterplatte aufliegend. Beim Verlöten der
Netzanschlussklemmen KL 1, KL 2, des Trafos TR 1 und des Relais REL 1
ist eine hinreichend große Menge Lötzinn zu verwenden, um hier zum einen
eine stabile, dauerhafte und zuverlässige Fixierung zu gewährleisten,
zum anderen aber auch um den elektrischen Übergangswiderstand und die
damit ggf. verbundenen thermischen Verluste gering zu halten.Gehäuseeinbau

|
| Bild
8: Die Aufbau-Reihenfolge des Gerätes mit Kabeldurchführungen,
Grundplatte, Controllerplatine und Abdeckung. Die Fixierung erfolgt
jeweils über Abstandshalter. |
Montage
Durch
die wasserdichte Ausführung ist das Gerät sowohl für die Montage in
Trocken- als auch in Feuchträumen geeignet. Der Montageort sollte so
gewählt werden, dass alle Regler problemlos empfangen werden.
Gegebenenfalls sollte dies vor der endgültigen Anbringung des Gerätes
getestet werden. Das Gerät ist für eine feste Montage vorgesehen, z. B.
durch Andübeln an einer Wand. Hierzu sind außerhalb des Dichtbereiches,
in den vier Ecken des Gehäuses, Löcher vorhanden. Um an die
Anschlussklemmen zu gelangen, sind die Abdeckplatte und die
Controllerplatine zu entfernen. Für die Kabelzuführung sind zwei
Verschraubungen vorhanden, die, nachdem das Kabel eingelegt und fest
verschraubt ist, zum einen den Kabeldurchtritt abdichten und zum anderen
gleichzeitig eine Zugentlastung gewährleisten. Damit dies einwandfrei
funktioniert, sollten die Kabel einen runden Querschnitt mit einem
Durchmesser von 4,5 bis 10 mm aufweisen. Falls der Relaisanschluss des
FHT 8W nicht genutzt wird, so sollte die zweite, ungenutzte
Kabelverschraubung mit dem beiliegenden Blindstopfen verschlossen
werden. Die Anschlusskabel sind vor den Anschlussklemmen so zu verlegen,
dass sie nicht in den Bereich der Elektronik ragen. Dies gilt
insbesondere auch nach oben in den Bereich der Controllerplatine und
seitlich zwischen Netzanschluss und Relaisanschluss. Wenn ein sicherer
Abstand zu den Leitungen nicht gewährleistet werden kann, dann ist eine
doppelte Isolation notwendig. Diese kann z. B. dadurch realisiert
werden, dass über die nicht vom Kabelmantel umgebenen Bereiche der
Einzeladern Silikonschlauch oder Glasgewebeschlauch geschoben wird.
Achtung!
Grundsätzlich gilt für die Installation und Inbetriebnahme, dass
Arbeiten am 230-V-Netz nur von einer Elektro-Fachkraft (nach VDE 0100)
durchgeführt werden dürfen. Hierbei sind alle national gültigen Normen
und Richtlinien sowie die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.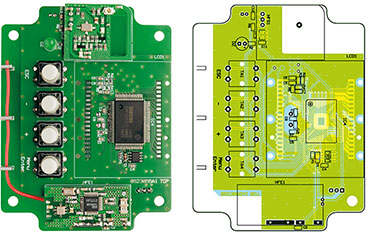
|
| Ansicht der fertig bestückten Displayplatine mit zugehörigem Bestückungsdruck von der Bestückungsseite |
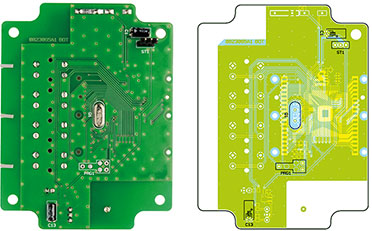
|
| Ansicht der fertig bestückten Displayplatine mit zugehörigem Bestückungsdruck von der Lötseite |
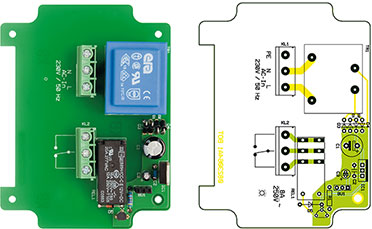
|
| Ansicht der fertig bestückten Basisplatine mit zugehörigem Bestückungsdruck |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (6 Seiten)
als PDF (6 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Ökonomisch heizen – Wärmebedarfsrelais FHT 8W Teil 2/2
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
| weitere Fachbeiträge | Foren | |
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo





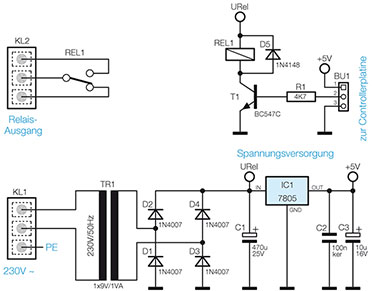
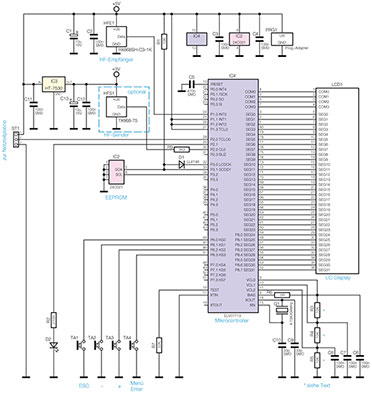


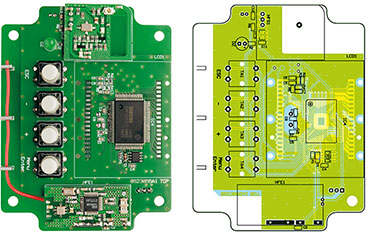
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (6 Seiten)
als PDF (6 Seiten)