FS20-Makrosteuerung FS20 MST 1 – Makros ohne PC und Zentrale! Teil 2/2
Aus ELVjournal
02/2008
0 Kommentare
Vielseitig
Der
Rollladen schließt sich, das Licht wird eingeschaltet und während der
nächsten Minute sanft herabgedimmt, die Leinwand fährt herab, der Beamer
springt an, der DVD-Player und die Audioanlage ebenfalls – der
gemütliche Filmabend kann beginnen! Und für dieses ganze Szenario bedarf
es nur eines einzigen Knopfdrucks, wenn man unsere Makrosteuerung
bemüht. Der „Knopf” kann dabei sowohl eine Taste einer
FS20-Fernbedienung sein als auch ein Wandtaster, der einfach an die
Makrosteuerung FS20 MST 1 angeschlossen wird. Denn die verfügt auch über
6 Kontakteingänge, die beliebigen, im Gerät gespeicherten Makros
zugeordnet werden können.
Die Makrosteuerung verfügt nicht nur über den Vorteil, bis zu 50
verschiedene Makros mit einer variablen Anzahl von Einzelaktionen
speichern zu können, sie kann auch innerhalb des FS20-Systems
Adressgruppen- und sogar Hauscode-übergreifend Geräte ansprechen. So
sind z. B. die verschiedensten Beleuchtungsszenarien realisierbar, etwa
das gemeinsame oder sequenzielle Schalten und Dimmen unterschiedlicher
Leuchten zu verschiedenen Jahreszeiten.
Wenden wir uns der Schaltungstechnik des Gerätes zu.Schaltung
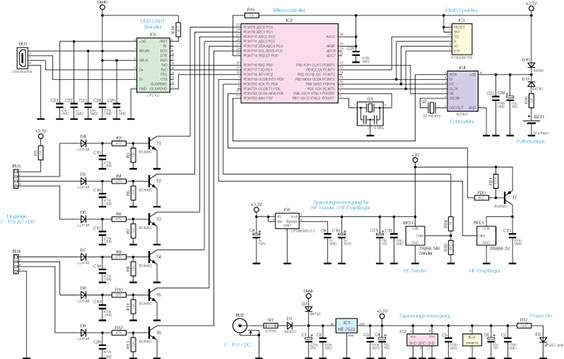
|
| Bild 4: Schaltbild der Makrosteuerung FS20 MST 1 |
Nachbau
a
die Handhabung von SMD-Komponenten einiger Übung bedarf, sind sie
bereits alle werkseitig bestückt. Der Nachbau beschränkt sich daher auf
das Bestücken der bedrahteten Bauteile und den Einbau ins Gehäuse. Wie
gewohnt erfolgt die Bestückung anhand des Bestückungsplans, der
Stückliste und unter Zuhilfenahme der Platinenfotos. Die Anschlüsse der
bedrahteten Bauelemente werden durch die entsprechenden Bohrungen der
Platine geführt und von der Rückseite her verlötet. Bei den
Elektrolyt-Kondensatoren und der LED D 3 ist auf die richtige Polarität
zu achten. Elkos sind üblicherweise am Minuspol durch eine
Gehäusemarkierung gekennzeichnet. Die Anode der LED (Plus-Markierung im
Bestückungsdruck) ist durch den längeren Anschluss zu erkennen. Die LED
ist so zu verlöten, dass der Abstand zwischen der Platine und der
Oberseite des LED-Gehäuses ca. 14 mm beträgt. Nachdem alle Elkos und die
LED bestückt sind, wird die Batteriehalterung auf die Leiterplatte
montiert. Dazu ist zunächst die Halterung auf der Bestückungsseite zu
positionieren und dann sind von der Lötseite aus die beiden M2-Schrauben
durch die entsprechenden Löcher zu stecken. Mit den beiden
Fächerscheiben und Muttern wird die Halterung dann fixiert. Es ist
darauf zu achten, dass die Halterung keinen Kontakt zur
Massefläche hat. Als Nächstes sind die Buchsen BU 1 bis BU 4 zu
bestücken. Die Buchsen sollten direkt auf der Leiterplatte aufliegen, so
dass die mechanische Beanspruchung der Lötstellen so gering wie möglich
ist.
Als Letztes sind nun noch das HF-Empfangs- und HF-Sendemodul zu
bestücken. Sie werden, wie in Abbildung 5 und
Abbildung 6 gezeigt, in einem Abstand von ca. 1 cm zur
Platine eingelötet. Das Sendemodul ist bereits mit entsprechenden
Lötstiften bestückt, für das Empfangsmodul müssen die beiliegenden
Lötstifte verwendet werden.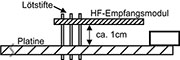
|
| Bild 5: Die Montage des Empfangsmoduls … |
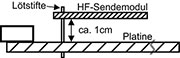
|
| Bild 6: … und des Sendemoduls |
Inbetriebnahme
Nachdem
die Spannungsversorgung hergestellt ist (z. B. Steckernetzteil), kann
die Makrosteuerung mit einem USB-Kabel an einen PC angeschlossen werden.
Das Windows-Betriebssystem erkennt nun, dass ein neues Gerät
angeschlossen ist, und verlangt nach einem Gerätetreiber. Die
Installation des Treibers und der PC-Software erfolgt laut Abschnitt
„Installation“ (siehe Teil 1).
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, kann die Anwendungssoftware
gestartet und mit dem Programmieren der Makros begonnen werden.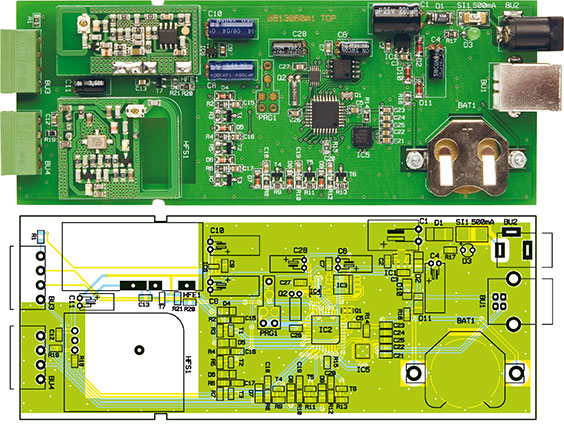
|
| Ansicht der fertig bestückten Platine der Makrosteuerung mit zugehörigem Bestückungsplan |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- FS20-Makrosteuerung FS20 MST 1 – Makros ohne PC und Zentrale! Teil 2/2
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
| weitere Fachbeiträge | Foren | |
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo





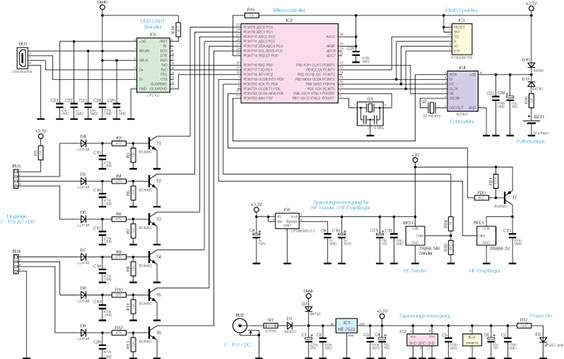
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)