Power-Saver PS 100 - Stand-by-Abschaltung mit IR-Fernbedienung
Aus ELVjournal
03/2008
0 Kommentare
Technische Daten
| Einschalten der Netzspannung | über angelernte IR-Fernbedienung |
| Ausschalten der Netzspannung | automatisch 30 Sek. nach Erreichen der zuvor angelernten Stand-by-Stromstärke |
| Anzahl anlernbarer Fernbedienungen | 3 |
| Unterstützte IR-Übertragungsprotokolle | RC5, RC6, RECS80, RCMM, NEC-Code, Sharp-Code, R-200, SIRC, Toshiba, Micom Format und weitere ähnlich aufgebaute Protokolle |
| Anzeige | rote LED für Schaltzustand und Anlernen |
| Bedienelemente | Taster zum Anlernen |
| Speichern der Einstellungen | netzausfallsicher im EEPROM |
| Betriebsspannung | 230 V/50 Hz |
| Max. Stromaufnahme ohne Geräte | 0,07 A |
| Wirkleistung im Stand-by (Relais aus) | 0,3 W |
| Wirkleistung im Betrieb (Relais ein) | 1 W |
| Maximale Schaltleistung/Schaltstrom | 1380 W/6 A |
| Kabellänge Netzkabel und Mehrfachdose | jeweils 1,40 m |
| Abmessungen Gehäuse (B x H x T) | 60 x 30 x 112 mm |
Bis
zu 2 große Kraftwerke arbeiten in Deutschland nur für die
Bereitstellung der Leistung, die viele Elektrogeräte im Stand-by-Betrieb
benötigen. Dies führt in jedem Haushalt zu Stromkosten von bis zu 100
Euro
pro Jahr. Durch eine intelligente Abschaltelektronik wie dem hier
vorgestellten Power-Saver PS 100 können
diese Ausgaben bequem eingespart werden.Kosten sparen durch Stand-by-Abschaltung
Trotz
der ständig steigenden Stromkosten verzichten noch immer viele
Hersteller von Unterhaltungselektronik auf energiesparende Schaltungen
für die Stand-by-Funktion ihrer Produkte. Die eingesetzte preiswertere
Elektronik führt jedoch im Endeffekt zu einer erheblichen Mehrbelastung
für den Eigen tümer und für die Umwelt. In einer Veröffentlichung aus
dem Jahr 2006 gibt das Umweltbundesamt diese Kosten mit mindestens 4
Milliarden Euro an. Bereits 1 Watt Standby- Leistung kostet den
Verbraucher ungefähr 1,50 Euro pro Jahr. Zwar beginnen heute einige
Hersteller, Geräte mit niedrigem Stand-by-Stromverbrauch zu produzieren,
was jedoch die wenigsten neuen Geräte betrifft. Eine Leistungsaufnahme
zwischen 3 und 20 Watt pro Komponente ist üblich und führt je nach
Geräteanzahl zu Stromkosten von bis zu 100 Euro pro Jahr – einfach zu
viel!Stand-by-Betrieb
ist andererseits für den Benutzer eine feine Sache – es genügt der
bequeme Griff zur Fernbedienung, um die Geräte aus der Ferne ein- und
auszuschalten. In den ersten Jahren des Einsatzes dieser Technik kam
noch hinzu, dass die Hersteller geradezu vorschrieben, die Geräte
niemals vollständig vom Stromnetz zu trennen, da sonst alle
Nutzereinstellungen wie Senderspeicher oder die zuletzt gewählten
Einstellungen gelöscht würden. Erst durch den Einsatz von
EEPROM-Speicherbausteinen änderte sich das, und heute bleiben bei den
meisten Geräten auch beim vollständigen Abschalten die Einstellungen
erhalten. Lediglich zeitgesteuerte Geräte wie Videorecorder oder
Festplattenreceiver sollten nicht vom Netz getrennt werden, da sie sonst
nicht selbstständig Sendungen aufzeichnen könnten. Bei diesen Geräten
lohnt es sich, bereits beim Kauf auf eine geringe Leistungsaufnahme im
Stand-by zu achten. Alle anderen Geräte lässt man heute nur noch
aufgrund des Bedienkomforts im Standby, um sie jederzeit bequem per
Fernbedienung einschalten zu können. Dies führt jedoch zu den genannten
Kosten. Dabei
lassen sich diese Ausgaben leicht vermeiden. Bereits 1997 hatte ELV den
Power-Saver PS 97 entwickelt, der automatisch erkannte, wann ein
angeschlossener Fernseher in den Stand-by-Betrieb wechselt, und ihn dann
vollständig abgeschaltet hat. Die gesamte Leistungsaufnahme wurde damit
auf unter 1 Watt gesenkt, da lediglich der Power-Saver ständig in
Bereitschaft blieb. Das Einschalten erfolgte bequem über die
TV-Fernbedienung. Heute, zehn Jahre später, befinden sich nur wenige
ähnlich funk tionierende Geräte auf dem Markt. Die erhältlichen Produkte
sind zudem größtenteils weder auf dem Stand der Technik noch glänzen
sie durch Qualität und Funktion. Bei genauerem Hinsehen fallen sogar
einige verbreitete Geräte durch ihre mangelhafte Qualität dermaßen auf,
dass sie für den Verbraucher bereits ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Zudem reagieren diese Geräte auch ungewollt auf jedes IR-Signal. Hier
soll nun der PS 100 eine Lücke schließen, der, ausgerüstet mit einer
präzisen Strommesstechnik und einem lernfähigen IR-Empfängersystem, auch
in der Lage ist, nur auf bestimmte Fernbedienungsbefehle zu reagieren.
Dadurch kann beispielsweise eine häufig genutzte Musikanlage per
Fernbedienung bedient werden, ohne dass der am PS 100 angeschlossene
Fernseher mit angeschaltet wird. Das einfache, gezielte Anlernen von bis
zu 3 Fernbedienungen an den PS 100 ermöglicht es, sowohl mehrere Geräte
an einem PS 100 anzuschließen als auch mehrere PS 100 gleichzeitig in
einem Raum einzusetzen. Abbildung 1 zeigt zwei mögliche
Geräte-Kombinationen. 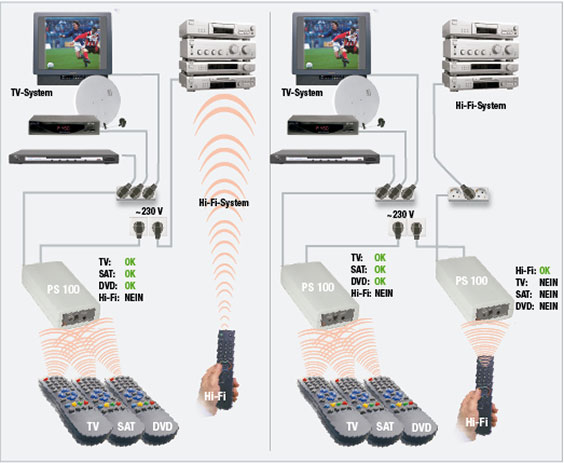
|
| Bild
1: Einzel- und Mehrfacheinsatz des PS 100: Durch gezieltes Anlernen der
gewünschten Fernbedienungen wird eine gegenseitige Beeinflussung
ausgeschlossen – was nicht im jeweiligen PS 100 gespeichert ist, wird
ignoriert! |
Im
linken Beispiel sind ein Fernsehgerät, ein DVD-Player und ein Receiver
an einem PS 100 angeschlossen. Die Ein/Aus- Tasten der 3 zugehörigen
Fernbedienungen sind am PS 100 angelernt. Wird nun eine der
Fernbedienungstasten gedrückt gehalten, so versorgt der PS 100 zuerst
das ganze TV-System mit Netzspannung. Direkt im Anschluss schaltet sich
das gewünschte Gerät ein, da nun auch dieses den Befehl von der
Fernbedienung empfängt. Die anderen Geräte können anschließend mit der
jeweils zugehörigen Fernbedienung eingeschaltet werden. Nachdem alle
Geräte wieder in den Stand-by-Zustand versetzt sind, erkennt dies der PS
100 anhand des gemessenen Stroms und trennt das ganze System nach 30
Sekunden wieder von der Netzspannung ab. Das im selben Raum aufgestellte
Hi-Fi-System kann gleichzeitig über Fernbedienung bedient werden, ohne
dass der PS 100 das TV-System wieder ans Stromnetz schaltet. Das nicht
angelernte IR-Signal wird einfach ignoriert. Im
rechten Beispiel in Abbildung 1 ist am ersten PS 100 wieder das
TV-System angeschlossen. Zusätzlich gibt es in diesem Fall einen zweiten
PS 100, an dem das Hi-Fi-System angeschlossen ist. Drei Fernbedienungen
sind am ersten Power-Saver und eine ist am zweiten PS 100 angelernt
(natürlich können auch hier drei Fernbedienungen angelernt werden). Hört
man nun den ganzen Tag Musik, so bleiben Fernsehgerät, DVD-Player und
Receiver ausgeschaltet und nehmen keine Leistung auf. Am Abend hingegen,
wenn die TV-Anlage in Betrieb ist, nimmt so das Hi-Fi-System keinen
Strom auf. Durch solch eine gezielte Zusammenstellung der Geräte lässt
sich das Sparpotential optimal ausnutzen. Im Übrigen lassen sich auf
diese Weise beliebige Geräte ein- und ausschalten, auch wenn sie selbst
nicht über eine Fernbedienung gesteuert werden. Bestes Beispiel ist das
PCSystem. Moderne Computer und Monitore nehmen auch im scheinbar
ausgeschalteten Zustand weiter Strom auf, was man aber meist nicht
einmal an einer Kontrollleuchte sieht! Hier kann man sich zwar mit der
berühmten schaltbaren Steckdosenleiste behelfen, aber mit dem PS 100 und
einer beliebigen Fernbedienung geht das wesentlich eleganter und
komfortabler! Gleiches gilt auch für andere heimliche Stromfresser im
Haushalt. Installation und Bedienung
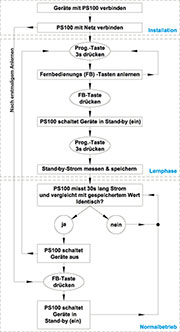
|
| Bild 2: Das Funktionsdiagramm des PS 100 |
Das
Anlernen wird gestartet, indem die Programmier-Taste des PS 100 für
mindestens 3 Sekunden gedrückt wird und die rote LED aufleuchtet.
Daraufhin hält man die Fernbedienung in Richtung des IR-Empfängers und
drückt die gewünschte Fernbedienungstaste einmal kurz. Die Fernbedienung
sollte dabei mindestens einen Meter vom Empfänger entfernt gehalten
werden, damit nicht ein zu starkes IR-Signal den übertragenen IR-Code
verfälscht. Die rote LED erlischt erst wieder, wenn die Lernphase
abbricht (LED geht ohne zu blinken aus) oder wenn sie erfolgreich
beendet wird (LED blinkt zweimal). Ein Abbruch erfolgt entweder gewollt
durch nochmaliges Drücken der Programmier-Taste oder durch ein
fehlerhaftes IR-Signal, was beispielsweise von einer störenden
Leuchtstofflampe herrühren kann. Für ein Anlernen weiterer
Fernbedienungstasten ist die beschriebene Prozedur zu wiederholen. Wird
anschließend eine der angelernten Tasten betätigt, so schaltet der PS
100 die angeschlossenen Geräte ans Stromnetz und bringt diese damit in
den Stand-by-Betrieb. Dabei ist zu beachten, dass einige Geräte nicht
direkt in den Standby- Betrieb gehen, sondern sich vollständig
einschalten, nachdem sie mit Spannung versorgt werden. Dies gilt
insbesondere für Set-Top-Boxen, Satelliten- und Kabel-Receiver, die z.
B. nach neu angeschlossenem Zubehör oder nach einer neuen Firmware
suchen. Nach einiger Zeit sollten auch diese Geräte selbstständig in den
Stand-by-Betrieb wechseln. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten solche
Geräte manuell in den Stand-by geschaltet werden. Erst wenn
sichergestellt ist, dass sich alle Geräte im Stand-by-Modus befinden,
ist die Programmier-Taste am PS 100 für mindestens 3 Sekunden zu
drücken, womit der aktuelle Stromfluss gemessen und im EEPROM
gespeichert wird. Dieser Vorgang wird durch ein Blinken der LED
angezeigt. Das Speichern im EEPROM hat den Vorteil, dass die Daten auch
nach einem Stromausfall erhalten bleiben. Damit
ist der PS 100 betriebsbereit und schaltet die angeschlossenen Geräte
nach 30 Sekunden spannungsfrei, voraus gesetzt dass innerhalb dieser
Zeit kein Gerät eingeschaltet wird und den fortlaufend gemessenen Strom
dadurch erhöht. Sollten während der 30 Sekunden Geräte eingeschaltet
werden, so schaltet der PS 100 erst dann alles ab, nachdem das letzte
Gerät in den Stand-by-Betrieb gewechselt ist und erneut 30 Sekunden
vergangen sind. Zuletzt sollen zwei Sonderfunktionen beschrieben werden,
die durch eine bestimmte Vorgehensweise aktiviert werden können. Zum
einen kann der PS 100 in den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden,
indem alle gespeicherten Einstellungen gelöscht werden. Zum anderen kann
der PS 100 bei Bedarf in einen Einfach-Modus umgeschaltet werden. In
diesem Modus reagiert der PS 100 auf alle IR-Fernbedienungen, ohne dass
bestimmte IR-Codes angelernt werden müssen. Dieser Modus kann eventuell
weiterhelfen, wenn die gewünschte Fernbedienung nicht ganz kompatibel
ist und sich nicht richtig anlernen lässt. Aktiviert
werden diese Sonderfunktionen durch den folgenden Ablauf: Zuerst wird
der PS 100 vollständig von der Netzspannung getrennt – entweder über
eine schaltbare Steckdosenleiste oder durch das Ziehen des
PS-100-Netzkabels. Anschließend wird die Programmier-Taste gedrückt
gehalten und das Netzkabel wieder eingesteckt bzw. die Steckdosenleiste
eingeschaltet. Während die Taste gehalten wird, blinkt die LED
regelmäßig auf. Wird die Taste nach zweimaligem Blinken losgelassen, so
wird der PS 100 vom Standardin den Einfach-Modus umgeschaltet (der
Wechsel zurück in den Standard-Modus erfolgt auf die gleiche Art und
Weise). Wird die Taste länger gedrückt gehalten, bis die LED 5-mal
geblinkt hat, so wird der PS 100 in den Auslieferungszustand
zurückgesetzt. Schaltung
Das Schaltbild des Power-Saver PS 100 ist in Abbildung 3 dargestellt.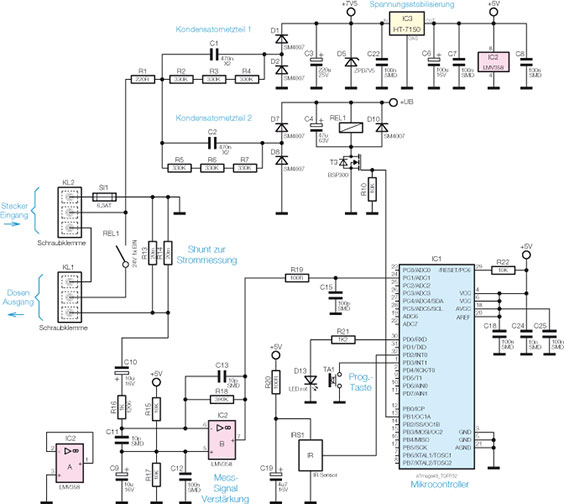
|
| Bild 3: Schaltbild des PS 100 |
Die
Erzeugung der beiden Betriebsspannungen für das Relais und die übrige
Elektronik erfolgt mittels zweier Kondensatornetzteile direkt aus der
230-V-Netzspannung. Aus diesem Grund gibt es keine galvanische Trennung,
wodurch alle Teile der Elektronik inklusive GND direkt mit der
Netzspannung verbunden sind! Der Betrieb der Schaltung ist daher
ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Gehäuse zulässig und bei Aufbau
und Inbetriebnahme sind die im Kapitel „Nachbau” gegebenen
Sicherheitshinweise zu beachten. Als strombegrenzende
Sicherheitselemente und kapazitive Vorwiderstände werden die beiden
X2-Kondensatoren C 1 und C 2 verwendet. Die Widerstandsketten R 2, R 3, R
4 und R 5, R 6, R 7 dienen der schnellen Entladung der Kondensatoren
bei Trennung des PS 100 vom Netz. Der in Reihe geschaltete
Metalloxidwiderstand R 1 begrenzt den Einschaltstrom, da C 1 und C 2 im
Einschaltmoment sehr kleine Widerstandswerte besitzen. Die
Dioden D 1 und D 7 bilden Einweg-Gleichrichter, die nur die positiven
Halbwellen durchlassen. Der Massebezug wird über die Klemmdioden D 2 und
D 8 festgelegt. Die Stabilisierung der 5-V-Versorgungsspannung erfolgt
über den Festspannungsregler IC 3. Der verwendete Typ HT-7150 verträgt
eingangsseitig bis zu 26 V, weshalb die Z-Diode D 5 die Eingangsspannung
auf einen zulässigen Wert begrenzt. Ohne die Z-Diode würde bei geringer
Last die Eingangsspannung auf weit über 100 V ansteigen. Mit der
Schutzfunktion wird zwar ein kontinuierlicher Strom über die Z-Diode in
Kauf genommen, der jedoch durch den Kondensator C 1 auf maximal 33 mA
begrenzt ist. Damit bleibt die Verlustleistung unterhalb von 0,25 W. Der
Kondensator C 3 glättet die Eingangsspannung und versorgt dadurch den
Spannungsregler IC 3 zwischen den positiven Halbwellen mit ausreichend
Strom. Der Keramik- Kondensator C 22 dient der Unterdrückung
hochfrequenter Störungen. Das zweite, mit C 2, D 7 und D 8 aufgebaute
Kondensatornetzteil bleibt während des Stand-by-Betriebs dauerhaft im
Leerlauf, ohne Leistung aufzunehmen. Erst wenn der PS 100 die
angeschlossenen Geräte mit Netzspannung versorgen soll, schaltet der
Mikrocontroller IC 1 den MOSFET-Transistor T 3 und damit das Relais REL
1. Die Kapazität von C 2 ist dabei so gewählt, dass sich mit dem
fließenden Strom am Relais eine Spannung von ca. 20 V einstellt. Der
Elko C 4 glättet diese pulsierende Spannung. Im
Leerlauffall nimmt dieses Kondensatornetzteil zwar fast keine Leistung
auf, jedoch bewirkt die fehlende Last eine hohe Drain-Source-Spannung
von 650 Vss an T 3. Der Transistor muss daher ein besonders
spannungsfester Typ mit einer Durchbruchspannung von über 700 V sein.
Aber auch ein Durchbruch würde in der vorliegenden Schaltung den
Transistor nicht zerstören, da C 2 den Strom auf 33 mA begrenzt. Nach
einem Durchbruch würde die Drain-Source-Spannung sofort auf unter 1 V
sinken und T 3 wieder sperren. Sobald die an Klemme KL 1 angeschlossenen
Geräte über den Relaiskontakt mit Netzspannung versorgt werden, fließt
ein Strom über die parallel geschalteten 20-mΩ-Shunt-Widerstände R 13
und R 14. Bei einer Stand-by-Leistung von 23 W fließt beispielsweise ein
Strom von 100 mA, der an den Shunts einen Spannungsabfall von 1 mV
bewirkt. Solch kleine Signalpegel erfordern eine entsprechend hohe
Verstärkung, die mit dem Operationsverstärker IC 2 B realisiert wird.
Der Verstärkungsfaktor wird durch das Verhältnis von R 18 zu R 16
bestimmt. Der zum Stromfluss proportionale Spannungsverlauf gelangt nach
der Verstärkung zum A/D-Wandler des Mikrocontrollers. Da es sich bei
dem Signal um eine Wechselspannung handelt, wird ihr ein Gleichanteil
überlagert (DC-Offset), bevor es zum A/D-Wandler gelangt. Dieser kann
Eingangssignale von 0 bis 5 V digitalisieren. Der Gleichanteil wird über
den Spannungsteiler R 15 und R 17 am nicht-invertierenden Eingang des
Operationsverstärkers festgelegt. Der
Elko C 10 entkoppelt das Messsignal, während C 9 die Offset-Spannung
möglichst konstant hält. Der Keramik-Kondensator C 11 dient der
Unterdrückung von HF-Störungen und C 13 der Unterdrückung von
Schwingneigungen des OPs. Der Empfang des Einschaltbefehls mittels einer
Infrarot-Fernbedienung erfolgt über den IR-Empfänger IRS 1. Dieser
demoduliert ankommende IR-Signale und leitet sie direkt an den
Mikrocontroller weiter. Dieser speichert im Anlernmodus bis zu drei
empfangene IR-Codes dauerhaft im integrierten EEPROM. Im Normalbetrieb
vergleicht der Mikrocontroller alle neu empfangenen IR-Codes mit den
bereits gespeicherten und schaltet über T 3 das Relais, sobald eine
Übereinstimmung festgestellt wird. Über die Programmier-Taste wird dem
Mikrocontroller mitgeteilt, dass er einen neuen IR-Code einer gedrückten
Fernbedienungstaste erkennen und speichern soll oder dass er den
momentanen Stand-by-Strom messen und ebenfalls im EEPROM dauerhaft
speichern soll. Die rote LED D 13 zeigt an, ob das Relais angezogen ist,
ob sich der PS 100 in der Lernphase befindet und ob das Anlernen
erfolgreich war. Achtung:
Aufgrund
der im Gerät frei geführten Netzspannung dürfen Aufbau und
Inbetriebnahme nur von Fachkräften durchgeführt werden, die aufgrund
ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Die einschlägigen Sicherheits- und
VDE-Bestimmungen sind unbedingt zu beachten. Insbesondere ist bei allen
Arbeiten am geöffneten Gerät, z. B. bei der Reparatur, ein
Netz-Trenntrafo vorzuschalten, da beim PS 100 keine Netztrennung
vorhanden ist und daher an jedem Bauelement Netzspannung anliegt.
Nachbau
Zum
Nachbau ist unbedingt der Sicherheitshinweis zu beachten! Der größte
Teil der PS-100-Elektronik ist mit SMD-Bauteilen realisiert, die bereits
werkseitig bestückt sind. Nur noch wenige bedrahtete Bauteile sind von
Hand zu bestücken, so dass der praktische Aufbau schnell und einfach
erfolgen kann. Die Bestückung erfolgt in gewohnter Weise anhand der
Stückliste, des Bestückungsdrucks und des Schaltbildes. Die
Bauteilanschlüsse werden von oben in die dafür vorgesehenen Bohrungen
gesteckt und von unten verlötet. Bei den Elkos C 3, C 4, C 6, C 9, C 10
und C 19 und der Leuchtdiode D 13 ist unbedingt auf die richtige
Polarität zu achten. Falsch gepolte Elkos können sogar platzen. Der
Minuspol der Elkos ist auf einer Seite am Gehäuse gekennzeichnet. Auf
der Platine ist hingegen der Pluspol (+) deutlich markiert.Die
Anode (A) der LED ist durch den etwas längeren Anschluss
gekennzeichnet. Die LED wird so eingelötet, dass sich ihre
Gehäuseunterseite 10 mm über der Platinenoberfläche befindet. Nach dem
Einlöten wird die LED in 5 mm Höhe um 90° zur Vorderseite hin umgebogen,
so dass sie nach der Montage der Platine ins Gehäuse durch das
vorgesehene Sichtfenster in der Frontblende hindurchleuchten kann. Der
Taster TA 1 und der Infrarot-Empfänger IRS 1 werden so eingelötet, dass
sie plan auf der Platine aufliegen. Die Anschlüsse des IR-Empfängers
müssen in die genau passenden, nebeneinander liegenden drei Bohrlöcher
gesteckt und eingelötet werden. Die drei zusätzlichen, direkt daneben
liegenden Bohrlöcher sind für eine alternative Gehäusebauform vorgesehen
und bleiben frei. 
|
| Bild 4: So erfolgt die richtige Bestückung des IR-Empfängers. |

|
| Bild 5: Abmessung und Form der Shunt-Widerstände |

|
| Bild 6: Die ordnungsgemäß eingelöteten Shunt-Widerstände |
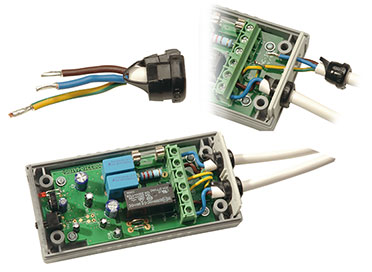
|
| Bild
7: Der Anschluss der Netzkabel: Links sieht man den über das Kabel
geführten Zug- und Knickschutz, in der Mitte das Einsetzen des Kabels in
die Gehäuserückwand und rechts die fertig geklemmte Verkabelung. |
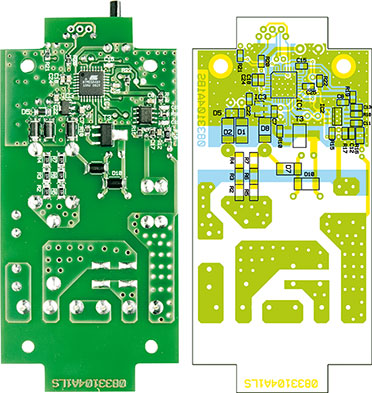
|
| Ansicht
der fertig bestückten Platine des PS 100 mit zugehörigem
Bestückungsplan, oben von der Bestückungsseite, unten von der Lötseite |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (7 Seiten)
als PDF (7 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Power-Saver PS 100 - Stand-by-Abschaltung mit IR-Fernbedienung
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Zu diesem Produkt gibt es 1 Beiträge im Forum
Hinterlassen Sie einen Kommentar:

 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo





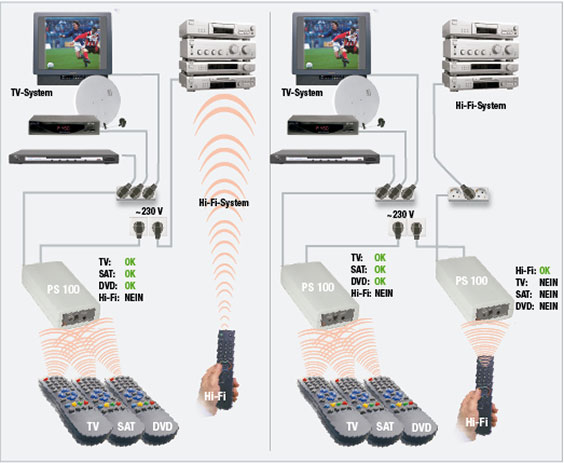
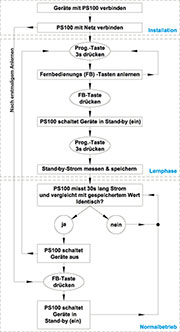



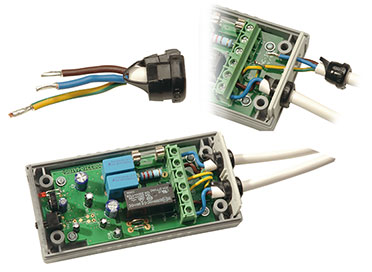
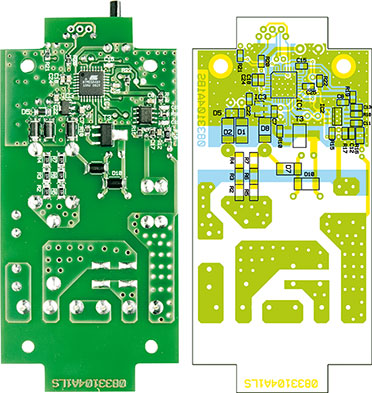
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (7 Seiten)
als PDF (7 Seiten)