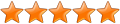Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
- FAQ-Datenbank
- Batterien, Akkus, Ladegeräte
- Bausätze, Lernpakete, Literatur
- Beleuchtung
- Computer-/Netzwerktechnik
- Electronic Components
- Hausautomation - Smart Home
- Haustechnik
- Kfz-Elektronik
- Klima-Wetter-Umwelt
- Messtechnik
- Modellsport, Freizeit
- Multimedia-SAT-TV
- Netzgeräte, Wechselrichter
- Sicherheitstechnik
- Telefon-/Kommunikationstechnik
- Werkstatt, Labor
- Ratgeber
- Batterien - Akkus - Ladegeräte
- Bausätze
- Beleuchtung
- Computer-/Netzwerktechnik
- Electronic-Components
- Freizeit- und Outdoortechnik
- Hausautomations-Systeme
- Haustechnik
- Kfz-Technik
- Klima - Wetter - Umwelt
- Messtechnik
- Multimedia - Sat - TV
- Netzgeräte - Wechselrichter
- Sicherheitstechnik
- Telefon-/Kommunikationstechnik
- Werkzeug - Löttechnik
- Elektronikwissen
- So funktioniert´s
- Praxiswissen
- FAQ-Datenbank
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
- ELVintern
- Experten testen
- Praxiswissen
- So funktioniert´s
- Hausautomation - Smart Home
- Haustechnik
- Beleuchtung
- Sicherheitstechnik
- Klima - Wetter - Umwelt
- Computer/Netzwerk
- Multimedia - Sat - TV
- Telefon - Kommunikation
- Kfz-Technik
- Stromversorgung
- HomeMatic-Know-how
- Freizeit- und Outdoortechnik
- Werkzeug - Löttechnik
- Messtechnik
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo
Artikel: 0 Summe: 0,00 EUR
Prozessor-Schaltnetzteil SPS 5630 30 V/6 A Teil 2/3
Aus ELVjournal 04/2008
0 Kommentare

Bausatzinformationen
 |  |  |  |
| 3 | 7,5 | OK | 3/08 |
Nachdem im „ELVjournal” 3/2008 die komplette Schaltungsbeschreibung des Prozessor-Schaltnetzteils SPS 5630 abgeschlossen wurde, kommen wir nun zum praktischen Aufbau und zum Abgleich, der komfortabel softwaregesteuert durchzuführen ist. Durch den übersichtlichen Aufbau, SMD-vorbestückte Leiterplatten und dadurch, dass innerhalb des Gerätes kein Hardware-Abgleich erforderlich ist, wird eine hohe Nachbausicherheit erreicht.
Nachbau
Trotz des Schaltungsumfangs ist der praktische Aufbau dieses interessanten Netzgerätes nicht schwierig. Aufgrund der übersichtlichen Konstruktion und da bei einem Großteil der Schaltung vorbestückte Komponenten in SMD-Ausführung zum Einsatz kommen, halten sich die Bestückungsarbeiten in Grenzen und sind recht schnell erledigt. Auch der komplett softwaregesteuert durchzuführende Abgleich trägt wesentlich zur Nachbausicherheit bei. Von Hand zu bestücken sind nur noch die Bauelemente in konventioneller Ausführung, wobei es sich vorwiegend um die Leistungselektronik auf der Basisplatine handelt. Insgesamt sind im SPS 5630 drei Leiterplatten vorhanden, wobei natürlich der wesentliche Teil der Komponenten auf der großen Basisplatine untergebracht ist. Neben der Basisplatine sind noch eine Frontplatine mit dem Display, den beiden Mikrocontrollern und den Bedienelementen sowie eine primärseitige Netzteilplatine vorhanden.Bestückung der Basisplatine
Wie bereits erwähnt, sind bei der großen Basisplatine sämtliche SMD-Komponenten an der Platinenunterseite vorbestückt. Bei den bedrahteten Bauelementen sind zuerst die Widerstände dem Bestückungsplan entsprechend einzulöten. Die Anschlüsse der Widerstände werden auf Rastermaß abgewinkelt, von oben durch die zugehörigen Platinenbohrungen geführt, an der Platinenunterseite leicht angewinkelt und verlötet. Danach werden die überstehenden Drahtenden, wie auch bei allen nachfolgend zu bestückenden Bauteilen, mit einem scharfen Seitenschneider direkt oberhalb der Lötstellen abgeschnitten.Im
nächsten Arbeitsschritt erfolgt die Bestückung der bedrahteten Dioden,
wobei unbedingt die korrekte Polarität zu beachten ist. Dioden sind
üblicherweise an der Katodenseite (Pfeilspitze) durch einen Ring
gekennzeichnet. Weiterhin ist zu beachten, dass bei den Leistungsdioden D
5 bis D 8 die Diodenkörper nicht direkt auf der Platinenoberfläche
aufliegen sollen. Zwischen Diodengehäuse und Platinenoberfläche ist ein
Abstand von ca. 2 bis 3 mm erforderlich. Die Anschlüsse des
Folien-Kondensators C 49 sind vor dem Verlöten an der Platinenunterseite
so weit wie möglich durch die zugehörigen Platinenbohrungen zu führen.
Die Anschlüsse der Keramik-Kondensatoren müssen vor dem Verlöten
unbedingt so weit wie möglich durch die zugehörigen Platinenbohrungen
geführt werden. Wie bereits erwähnt, sind auch hier die überstehenden
Drahtenden an der Platinenunterseite abzuschneiden.
Es
folgt die Montage der beiden Festspannungsregler IC 1 und IC 2. Bei
diesen Bauteilen werden zuerst die Anschlüsse ca. 3 mm hinter dem
Gehäuseaustritt um 90° abgewinkelt. Die Montage auf der Leiterplatte
erfolgt danach mit Schrauben M3 x 8 mm, Fächerscheiben und Muttern M3.
Erst wenn die Spannungsregler fest verschraubt sind, erfolgt das
sorgfältige Verlöten an der Platinenunterseite. Die
Platinen-Sicherungshalter für die beiden Feinsicherungen SI 1 bis SI 3
sowie für die Kfz-Flachsicherung SI 4 bestehen jeweils aus zwei Hälften.
Vor dem Verlöten müssen die Hälften der Sicherungshalter unbedingt plan
auf der Platinenoberfläche aufliegen. Unmittelbar nach dem Bestücken
der Halterungen werden die zugehörigen Sicherungen eingesetzt.
Weiter
geht es dann mit dem Einbau der Elektrolyt-Kondensatoren, deren
korrekte Polarität sehr wichtig ist. Falsch gepolte Elkos können
explodieren oder auslaufen. Bei den Elkos ist die Polarität meistens am
Minuspol gekennzeichnet. Eine danach einzulötende 14-polige Stiftleiste
(ST 8) stellt die Verbindung zur Frontplatine her. Die Stiftleisten
müssen vor dem Verlöten an der Platinenunterseite plan auf der
Platinenoberfläche aufliegen. Die Anschlüsse der Speicherdrossel L 1
sind auf die erforderliche Länge zu kürzen, vorzuverzinnen und in die
zugehörigen Platinenbohrungen zu löten. Danach wird die Spule mit einem
hitzebeständigen Kabelbinder auf der Platinenoberfläche befestigt. R 49
wird aus einem Manganindraht-Abschnitt von 33 mm Länge hergestellt und
mit einem Glasfaser-Isolierschlauch überzogen. Nach dem Einlöten in die
Platine (in einem Bogen nach oben) müssen 27,3 mm Länge des
Widerstandsdrahtes wirksam bleiben.
Montage des Leistungskühlkörpers
 |
| Bild 9: Die Montage von T 1 und D 13 am Kühlkörper |
 |
| Fertig eingebaute Leiterplatten und Trafo im Gehäuseunterteil |
 |
| Ansicht der fertig bestückten Basisplatine von der Bestückungsseite für konventionelle Bauteile mit zugehörigem Bestückungsplan |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen: als Online-Version
als Online-Version als PDF (5 Seiten)
als PDF (5 Seiten)Sie erhalten folgende Artikel:
- Prozessor-Schaltnetzteil SPS 5630 30 V/6 A Teil 2/3
- 1 x Journalbericht
| Produkte | weitere Fachbeiträge | Foren |
Hinterlassen Sie einen Kommentar: