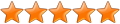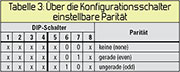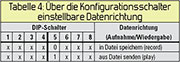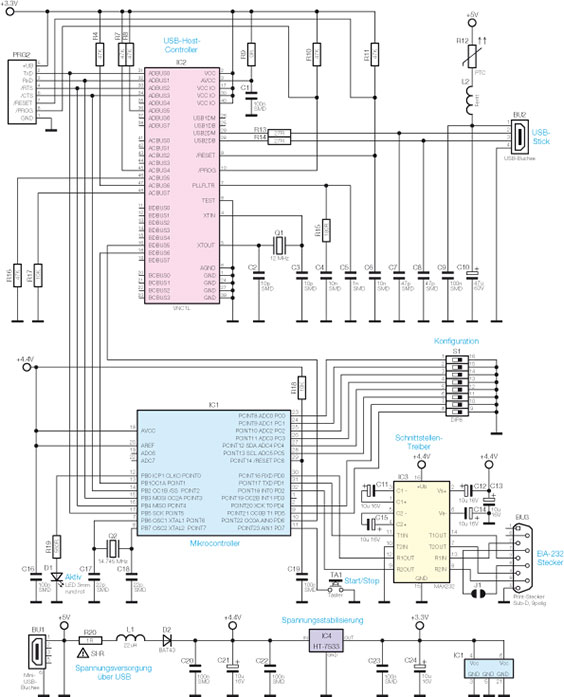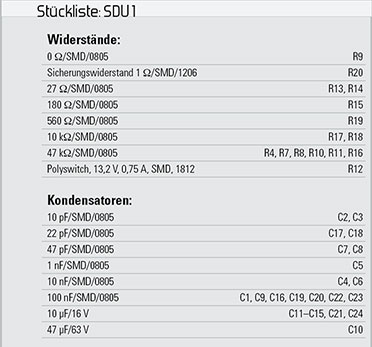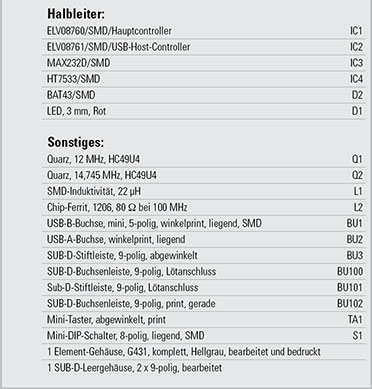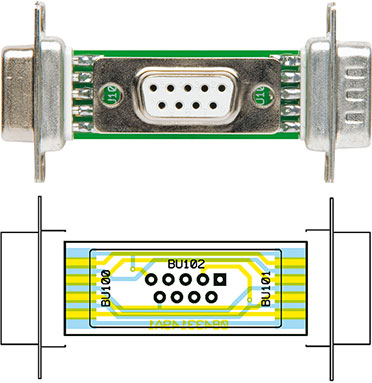Serieller Datenlogger SDU 1 für USB-Speicher-Sticks
Aus ELVjournal
04/2008
0 Kommentare
Technische Daten
| Schnittstelle | serielle EIA232 (RS232) |
| Übertragungsgeschwindigkeit (nicht kontinuierlich) | bis 115.200 Bit/s |
| Unterstützte Datenspeicher | handelsübliche USB-Sticks (bis 4 GB) |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT und FAT32 |
| Anzeigeelement | rote LED für Aktivitätsanzeige |
| Bedienelemente | 8fach DIP-Schalter und Taster |
| Fortlaufende Dateinummerierung | von 1 bis 100 Mio. im EEPROM gespeichert |
| Einstellungen | über DIP-Schalter oder Konfigurationsdateien |
| Spannungsversorgung | 5 VDC (UB-powered) über USB-Mini-B-Buchse |
| Stromaufnahme | max. 250 mA (je nach USB-Stick) |
| Abmessungen (B x H x T) | 51 x 26 x 92 mm |
| Im Lieferumfang | Adapterstecker zum "Mitloggen" |
Viele
Multimeter, GPS-Empfänger und andere Geräte besitzen auch heute noch
EIA232-Schnittstellen, um empfangene oder gemessene Daten ausgeben zu
können. Leider ist, trotz des einfachen Handlings dieser Schnittstelle,
für den Empfang und das Speichern von übertragenen Daten der Aufwand
eines angeschlossenen PCs notwendig. Dies macht gerade den mobilen
Einsatz solcher Geräte kompliziert und unfl exibel. Hier soll nun der
serielle Datenlogger SDU 1 in die Bresche springen, der alle Daten auf
einer EIA232-Schnittstelle mitloggt und direkt auf einen USB-Stick
speichert.Daten speichern ohne Ende
Geräte
mit seriellen Schnittstellen für die Datenausgabe sind nach wie vor
weit verbreitet, die Schnittstelle ist einfach beherrschbar und für
Software-Entwickler ebenso einfach programmierbar. Zudem gibt es für
eigene Applikationen kaum einen Mikrocontroller, der keine serielle
Schnittstelle aufweist. Solche Geräte, wie Multimeter oder
GPS-Empfänger, werden vorwiegend für das Protokollieren und Aufzeichnen
von Messdaten eingesetzt, sind allerdings, falls sie nicht über einen
eigenen Datenspeicher verfügen, an das Vorhandensein eines PCs gebunden.
Es gibt zwar Datenlogger für die serielle Schnittstelle, deren Speicher
eignen sich aufgrund der meist eher geringen und nicht erweiterbaren
Kapazität nur selten für die Langzeiterfassung. Angesichts der geradezu
riesigen Speicherkapazitäten mobiler Datenspeicher wie USB-Sticks,
SD-/MMC-Cards oder Compact-Flash- und anderer Speicherkarten ist eine
solche Technik mit fest verbautem Flash-Speicher nicht mehr up to date.
Zudem muss man beim traditionellen Datenlogger stets den gesamten
Datenlogger zum Auslesen transportieren, die Messwerterfassung ruht
zwischenzeitlich.Da
liegt es natürlich nahe, die erwähnten modernen Speichermedien für die
autarke Datenspeicherung einzusetzen. Sie haben auch den Vorteil, mobil
zu sein – man muss also nicht mehr den Messaufbau „auseinanderreißen”,
um die Daten auslesen zu können. Lediglich der Daten-Speicher, in
unserem Falle der USB-Stick, wird ausgetauscht und die Messung kann
fortgesetzt werden. Die bisher gesammelten Daten können irgendwo auf
einem entfernten PC wie üblich ausgelesen und ausgewertet werden. Der
hier vorgestellte serielle Datenlogger ist genau auf diese Aufgabe
zugeschnitten! Er wird einfach mit einem handelsüblichen USB-Stick (bis 4
GB) bestückt und kann so nahezu unbegrenzt Daten über seine
EIA232-Schnittstelle aufzeichnen. Das geht in zwei Varianten: Loggen als Endgerät

|
| Bild 1: Der SDU 1 speichert die Messdaten eines Multimeters auf den USB-Stick. |
Loggen als Mithörer

|
| Bild 2: Mit Hilfe des Adaptersteckers speichert der SDU 1 den Datenfl uss auf einer durchgeführten Leitung. |
Vielseitig
Der
Datenlogger ist für eine möglichst universelle und praktische
Verwendbarkeit ausgelegt, um den unterschiedlichsten Anwenderwünschen
gerecht zu werden. Im Aufnahme-Modus (Record) erfolgt
die Speicherung der empfangenen Daten auf dem USB-Stick im Rohformat
(Byte für Byte), ganz wie sie an der Schnittstelle auftreten. Die
eingestellte Konfiguration der Schnittstelle wird in einer Log-Datei
gespeichert. Auch der umgekehrte Weg ist möglich: Im Wiedergabe- Modus (Play)
können die gespeicherten Daten über die seriel le Schnittstelle auch
wieder ausgegeben werden – ideal, um etwa Gerätekonfigurationen und
Messdaten ohne eine direkte Kabelverbindung auf andere Geräte zu
übertragen. Die Schnittstelle ist jederzeit variabel über acht
DIP-Schalter konfigurierbar (Übertragungsgeschwindigkeit, Stopp-Bit,
Parität, Aufnahme-/Wiedergabe-Modus).
Zusätzlich
sind drei unterschiedliche Konfigurationseinstellungen auch über
Konfigurationsdateien möglich. Die dafür nötigen config-Dateien werden
mit einem kleinen Programmtool (als kostenfreier Download erhältlich)
auf einem Windows- PC erstellt und auf dem USB-Stick gespeichert. Die
jeweils gewünschte config-Datei ist einfach über die DIP-Schalter des
Datenloggers wählbar. Über diese config-Datei sind zusätzliche
Aufzeichnungs-/Wiedergabe-Funktionen möglich (z. B. wählbarer Dateiname
für die Wiedergabe-Datei, Anzahl der Datenbits wählbar, weitere
Baudraten). Ohne
das Kapitel „Bedienung” vorwegzunehmen, ein Satz zur einfachen
Bedienung des Gerätes: Nach der Konfiguration ist lediglich das
Starten/Stoppen der Datenaufnahme/ -wiedergabe über den Taster
„Start/Stop“ notwendig, die LED „Active” zeigt die Aktivitäten des
Datenloggers an. Die Stromversorgung des Gerätes erfolgt über eine
USB-Mini-Buchse (+5 V) entweder über ein Netzteil mit USB-Mini-B-Stecker
(ELV-Best.-Nr.: 84-724-96), einen Kfz-USB-Spannungswandler, wie man ihn
z. B. für das Laden von mobilen Navigationsgeräten, Mediaplayern oder
Handys im Auto verwendet, über einen aktiven USB-Hub oder über einen PC.
Dabei kommt ein normales USB-Kabel mit Mini-USB-Stecker auf einer Seite
zum Einsatz. Über einen entsprechend leistungsfähigen Akku ist sogar
mobiler Betrieb möglich, entsprechende Akku-Packs gibt es z. B. für das
Nachladen von Handys oder zur Versorgung von USB-Geräten. Als
Datenspeicher kommen handelsübliche USB-Sticks mit
USB-1.1/2.0-Schnittstelle zum Einsatz. Kurze USB-Speicher- Sticks
(Gehäuselänge <35 mm) passen vollständig ins SDU-1-Gehäuse, ohne
hervorzustehen. Längere USB-Sticks sind durch die Gehäuseeinführung
gegen versehentliches Abbrechen bzw. Herausziehen geschützt. Anwendungen
Wie
bereits angedeutet, sind die Einsatzmöglichkeiten des SDU 1 sehr
vielfältig. Wir wollen hier einige davon kurz betrachten. Da wäre
zunächst der Anschluss eines GPS-Empfängers (GPSMaus) und das
Aufzeichnen von Koordinaten, Geschwindigkeit, Richtung usw. z. B. im
Auto, um eine gefahrene Strecke später nachvollziehen zu können.
Derartige GPS-Daten können von diversen PC-Programmen weiterverwendet
und z. B. in einer Google™-Maps-Karte visualisiert werden. Ein weiteres
Anwendungsgebiet ist die Speicherung von Messdaten. Sei es, um
Langzeitmessungen aufzuzeichnen oder um Messdaten für Dokumentation,
Kontrolle oder Qualitätssicherung zu archivieren. Auch die bereits
erwähnte Möglichkeit, den Datenverkehr zwischen 2 Geräten aufzeichnen zu
können, bietet interessante Möglichkeiten. So können z. B. Messdaten
mitgelesen oder Steuerbefehle aufgezeichnet werden, um z. B.
Programmabläufe zu überprüfen. Auf diese Weise kann auch ein
Kommunikationsprotokoll analysiert werden, über das keine genaue
Dokumentation vorliegt.Ein
ähnliches Gebiet ist die mögliche Aktivierung/Bedienung von Geräten,
die über EIA232 gesteuert werden, ohne einen PC anschließen zu müssen.
Das kann entweder durch Wiedergabe von Befehlen geschehen, die auch
zuvor mit dem SDU 1 aufgezeichnet werden können oder die der Anwender am
PC in eine Datei speichert, die vom Datenlogger anschließend beliebig
oft wiedergegeben werden kann. Schließlich ist der SDU 1 auch als
geradezu gigantischer Datenspeicher für eigene
Mikrocontroller-Anwendungen nutzbar. Fast jeder Mikrocontroller verfügt
über mindestens eine serielle Schnittstelle, die mit sehr geringem
Aufwand (siehe auch das Schaltbild des SDU 1) in eine normgerechte
EIA232- Schnittstelle umgewandelt und so mit dem SDU 1 verbunden werden
kann. Gegenüber den sonst üblichen schmalen Speicherkapazitäten bei
μC-Schaltungen eröffnen sich über die bis zu mehreren Gigabyte großen
USB-Speicher ganz neue und vor allem einfach zu handhabende
Einsatzmöglichkeiten für eigene Mikrocontroller-Applikationen! Installation und Bedienung
Die
Inbetriebnahme und Bedienung des Datenloggers ist denkbar einfach. Nach
dem Anschließen der Spannungsversorgung am SDU 1 über die seitliche
USB-Mini-Buchse blinkt die LED „Active“ beim Systemstart einmal kurz
auf. Wird nun der Speicher-Stick in den USB-Port des SDU 1 gesteckt,
blinkt die LED nochmals auf, wenn der Speicher-Stick ordnungsgemäß
erkannt wurde. Dieser sollte im FAT- oder FAT32-Dateisystem formatiert
sein, was sich am PC schnell über „Laufwerksname->Eigenschaften“
überprüfen lässt.
|
| Bild 2: Mit Hilfe des Adaptersteckers speichert der SDU 1 den Datenfl uss auf einer durchgeführten Leitung. |

|
| Bild 1: Der SDU 1 speichert die Messdaten eines Multimeters auf den USB-Stick. |
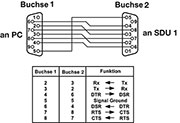
|
| Bild
3: Gekreuzte Beschaltung eines Nullmodem-Kabels, wie es für den
direkten Anschluss des SDU 1 an einen PC nötig ist, wobei nur die
Leitungen 2, 3 und 5 gebraucht werden. |
Aufnahme-Modus (Record)
Die
empfangenen Daten werden auf dem USB-Stick in einer neu angelegten
Rohdaten-Datei gespeichert. Als Dateiname wird eine fortlaufende Nummer
gewählt, die mit „00000001.DAT“ beginnend mit jeder neuen Aufnahme um
eins hochgezählt wird. Zurücksetzen lässt sich dieser im EEPROM
gespeicherte Dateizähler, indem alle acht DIP-Schalter in die obere
Position auf „On“ gestellt werden und anschließend die „Start/
Stop“-Taste kurz gedrückt wird. Angezeigt wird das Rücksetzen durch ein
dreimaliges Aufblinken der LED. Existiert eine Datei bereits, so wird
diese nicht überschrieben, sondern um die neuen Daten erweitert, indem
diese am Ende angehängt werden.Achtung:
Jede Aufzeichnung muss durch Drücken der „Start/Stop“-Taste beendet
werden, da sonst die gerade geschriebene Datei nicht abgeschlossen wird
und die gespeicherten Daten verloren gehen. Nach dem Drücken des Tasters
ist mit dem Rausziehen des USB-Sticks noch so lange zu warten, bis die
LED erloschen ist. Der USB-Stick darf auf keinen Fall aus dem SDU 1
herausgezogen werden, solange die LED leuchtet, da in diesem Fall ein
Datenverlust vorprogrammiert ist. Auch beim Abtrennen der
Stromversorgung würden alle Daten der gerade geschriebenen Datei
verloren gehen. (Im Fall des Datenverlustes kann eventuell ein Teil der
Daten mit dem Windows-Kommandozeilenprogramm „CHKDSK“ wiederhergestellt
werden.)
Wiedergabe-Modus (Play)
Nach
dem Start werden die Daten aus der zuletzt aufgenommenen Datei über die
serielle Schnittstelle ausgegeben – allerdings nur, wenn diese Datei
auch existiert und Daten enthält. Möchte man statt der letzten
Datendatei die vorletzte oder eine noch weiter zurückliegende Datei
ausgeben, so ist der Taster zum Start so lange gedrückt zu halten, bis
die LED zuerst wieder erlischt und dann periodisch kurz aufflackert. Je
nachdem wie häufig man die LED aufflackern lässt, wird mit jedem Blinken
eine weiter zurückliegende Datei gewählt (1x Blinken = vorletzte Datei,
2x Blinken = vorvorletzte Datei usw.). Nach dem Loslassen des Tasters
wird diese ausgegeben. Nachdem eine Datei vollständig ausgegeben wurde,
kann dieselbe Datei noch mal wiedergegeben werden, indem die Taste
wiederum gedrückt gehalten wird, bis die LED von selbst erlischt. Möchte
man noch weiter zurück, so wartet man vor dem Loslassen der Taste wie
zuvor das Blinken ab. Sobald die Taste zum Start aber nur kurz gedrückt
wird, springt der SDU 1 wieder zur neusten Datei zurück und gibt deren
Inhalt wieder.Mit
Hilfe des Konfigurationstools kann zuvor am PC auch eine bestimmte
Datendatei anhand ihres Dateinamens für die Wiedergabe ausgewählt
werden. Nachdem ein Datenfile einmal komplett gesendet ist, wird die
Wiedergabe automatisch beendet. Sowohl die Datenaufzeichnung als auch
die Datenwiedergabe können jederzeit durch nochmaliges Drücken der
„Start/ Stop“-Taste beendet werden. Die auf dem USB-Stick gespeicherten
Daten können anschließend direkt am PC ausgewertet werden. Dazu ist
(nach der Beendigung der Datenaufnahme und dem Erlöschen der LED) der
USB-Stick aus dem SDU 1 zu entfernen und in den PC zu stecken. Da die
gespeicherten Daten entsprechend dem zuvor angeschlossenen Gerät
unterschiedlichste Formate haben können, bleibt dem Anwender die
Auswertung über eine geeignete Software überlassen. Die Daten eines
GPS-Empfängers können beispielsweise direkt mit einem Texteditor
angeschaut werden. Dazu sollte man eventuell die Endung der Datei von
.dat auf .txt umbenennen. Dasselbe gilt für die Daten vieler Messgeräte,
auch hier erfolgt oft das Ablegen als (ASCII-)Textdatei. Diese können
häufig jedoch auch mit Excel importiert und weiterverarbeitet werden.
Daten, die nicht im ASCII-Format codiert sind, kann man mit einem
Hex-Editor wie beispielsweise WinHEX oder HTerm auswerten. Alle
empfangenen Datenbytes werden unformatiert und aufeinander folgend in
die jeweils neuste Datei gespeichert. In
den Tabellen 1 bis 5 sind alle direkt am SDU 1 vorzunehmenden
Konfigurationseinstellungen aufgelistet. Um diese Einstellungen
jederzeit parat zu haben, sind diese auch auf der Geräterückseite
aufgedruckt. Neben diesen Einstellmöglichkeiten gibt es noch einige
zusätzliche Optionen, die jedoch nur über das Konfigurationsprogramm
wählbar sind, das über die Internet-Angebotsseite des SDU 1 kostenfrei
zum Download bereitsteht. Schaltung
Das Schaltbild des SDU 1 ist in Abbildung 4 dargestellt.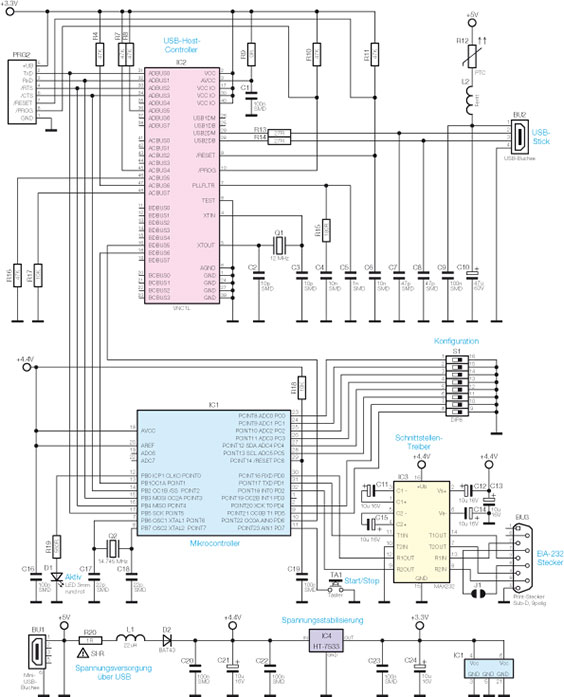
|
| Bild 4: Das Schaltbild des SDU 1 |
Als
zentrales Element dient der ATmega88-Mikrocontroller IC 1, dem IC 2,
ein VNC1L-USB-Host-Controller von Vinculum, für den USB-Speicherzugriff
zur Seite steht. Verbunden sind die beiden Bausteine über eine schnelle
SPI-Schnittstelle, die mit 3,7 MHz getaktet wird. Theoretisch könnte der
Datenlogger über diese schnelle Verbindung auch höhere Bitraten prob
lemlos und kontinuierlich verarbeiten, jedoch benötigt der VNC1L für das
Speichern auf dem USB-Stick im FAT/FAT32-Dateisystem Zugriffszeiten von
zeitweise mehr als 500 ms. Während dieses Zeitraums muss der ATmega88
alle eintreffenden Daten zwischenspeichern, wofür ihm nur ein begrenzter
Speicherbereich zur Verfügung steht. Sehr vorteilhaft ist die hohe
Integration vieler Funktionselemente im VNC1L. USB-Speicher-Sticks
lassen sich direkt an IC 2 anschließen und über einen einfachen
Befehlssatz beschreiben und auslesen. Extern werden lediglich der
12-MHz- Quarz Q 1, die zur Konfiguration des USB-Host-Controllers
dienenden Pull-up/down-Widerstände (R 4, R 7, R 8, R 9, R 10, R 11, R
16, R 17) und eine Reihe von Kondensatoren zur Spannungsglättung (C 24, C
10) und zur Störungsunterdrückung (C 1, C 6, C 7, C 8, C 9, C 20, C 22,
C 23) benötigt. Das PTC-Sicherheitselement R 12 begrenzt im Fehlerfall
den an der USB-Buchse BU 2 zur Verfügung stehenden Strom. Der
VNC1L benötigt eine eigene angepasste Firmware, die über die spezielle
Programmierschnittstelle PRG 2 bereits werkseitig implementiert wurde.
Die Versorgung des USB-Host-Controllers IC 2 erfolgt durch die mit IC 4
stabilisierte 3,3-V-Gleichspannung, während IC 1 seine Betriebsspannung
direkt aus der 5-V-Eingangsspannung erhält. Durch die Diode D 2 wird
lediglich der Spannungspegel auf ca. 4,4 V abgesenkt, um eine sichere
SPI-Verbindung zwischen IC 1 und IC 2 zu gewährleisten. Am Eingang von
IC 2 ist zwar auch ein Spannungspegel von 5 V zulässig, jedoch liegt
umgekehrt eine 3,3-V-Eingangsspannung bereits im Grenzbereich eines
zulässigen High-Pegels des ATmega88. Theoretisch könnte IC 1 zwar
ebenfalls mit 3,3 V betrieben werden, allerdings nicht bei der hohen
Taktrate von 14,7456 MHz. Eine an der USB-Mini-Buchse BU 1 anliegende
Eingangsspannung wird direkt zur Buchse BU 2 und damit auch an einen
angeschlossenen USB-Stick weitergeleitet. Aus diesem Grund muss
unbedingt darauf geachtet werden, dass ausschließlich stabilisierte und
geglättete 5-V-Spannungsquellen verwendet werden. Die Buchse BU 1 hat
keine weitere USB-Funktionalität und dient nur zur Versorgung des SDU 1
über einen angeschlossenen PC oder über andere USB-Spannungsquellen. Als
Bedienelemente dienen der an IC 1 angeschlossene 8fach- DIP-Schalter S
1, der Taster TA 1 und die rote LED D 1. Die EIA232-Schnittstelle des
SDU 1 ist über den MAX232- Schnittstellentreiber IC 3 am ATmega88
angeschlossen. Für die Erzeugung der ±9-V-Spannung auf der
EIA232-Schnittstelle benötigt dieser Baustein als externe Beschaltung
die fünf Elkos C 11 bis C 15. Die im Schaltbild als J 1 bezeichneten
Lötpads können bei Bedarf miteinander verbunden werden, wenn ein
angeschlossenes Gerät einen Hardware-Handshake (RTS->CTS) benötigt.
Signalisiert solch ein Gerät auf der RTS-Leitung (Request to send), dass
es zum Senden bereit ist, so erhält es aufgrund der J-1-Verbindung
gleichzeitig auf der CTS-Leitung (Clear to send) ein O. k. fürs Senden
zurück. Im Normalfall bleibt J 1 aber offen, da kaum ein Gerät
Hardware-Handshakes verwendet. 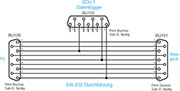
|
| Bild 5: Das Schaltbild des SDU 1-Adaptersteckers. Geloggt werden die Daten auf Leitung 2. |
Nachbau
Ein
Großteil der SDU-1-Elektronik ist werkseitig bereits bestückt, da es
sich um empfindliche SMD-Bauteile handelt. Einige bedrahtete Bauteile
sind jedoch noch von Hand zu bestücken. Dies geschieht in gewohnter
Weise mit Hilfe der Stückliste, des Bestückungsdrucks und des
Schaltbildes. Mit Ausnahme von LED D 1 werden alle Bauteile mit ihren
Anschlüssen von oben in die dafür vorgesehenen Bohrungen gesteckt und
von unten verlötet. Bei den Elkos C 10 bis C 15, C 20, C 21, C 24 und
der Leuchtdiode D 1 ist beim Einlöten unbedingt auf die richtige
Polarität zu achten. Falsch gepolte Elkos können sogar platzen. Der
Minuspol der Elkos ist auf einer Seite am Gehäuse gekennzeichnet. Auf
der Platine ist hingegen der gegenüberliegende Pluspol markiert. Der auf
der Platine durch ein Plus gekennzeichnete Anodenanschluss der LED ist
am Bauteil selbst durch den längeren Anschluss zu erkennen. Die
LED-Anschlüsse werden von unten so weit durch die Platine gesteckt, bis
das LED-Gehäuse aufliegt, und von oben verlötet. Bei den Quarzen ist
darauf zu achten, dass in die mit Q 1 bezeichneten Bohrungen der
12-MHz-Quarz und in Q 2 der 14,745-MHz-Quarz gelötet wird.
|
| Bild 6: Seitliche Ansicht der bestückten SDU-1-Platine |

|
| Bild
7: Für den Einbau der Platine muss diese zusammen mit der Frontplatte
seitlich in die Gehäuseschale hineingedreht werden. Vorher ist der
Tasterkopf in seine Bohrung zu stecken. |

|
| Bild 8: Richtig eingesetzte Platine mit eingestecktem USB-Stick |

|
| Bild 9: Seitliche Ansicht des fertig zusammengelöteten Adaptersteckers des SDU-1-Adapters |
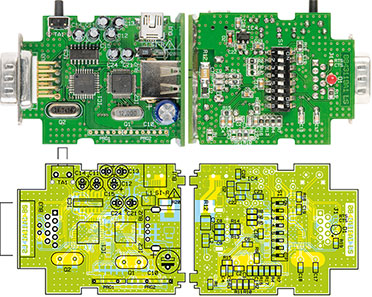
|
| Ansicht
der fertig bestückten Platine des SDU 1 mit zugehörigem
Bestückungsplan, links von der Bestückungsseite, rechts von der Lötseite |
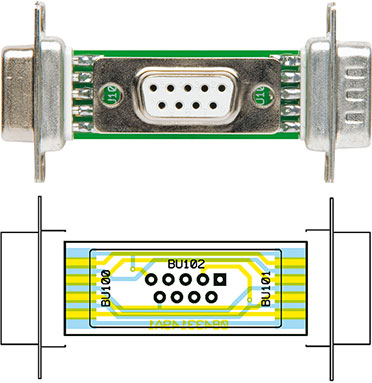
|
| Fertig bestückte Buchsenplatine mit zugehörigem Bestückungsplan |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (8 Seiten)
als PDF (8 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Serieller Datenlogger SDU 1 für USB-Speicher-Sticks
- 1 x Journalbericht
- 1 x Schaltplan
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo









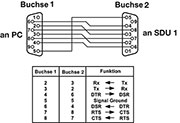

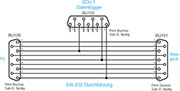




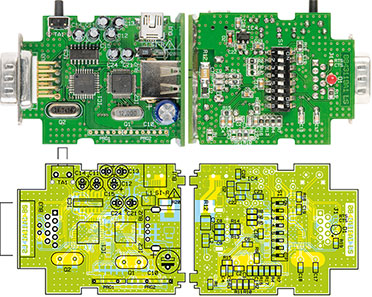
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (8 Seiten)
als PDF (8 Seiten)