Akku-Lade-Center ALC 3000 PC Teil 3/4
Aus ELVjournal
06/2008
0 Kommentare
Nachbau
Beim
ALC 3000 PC handelt es sich um ein leistungsfähiges Ladegerät aus der
ALC-Ladegeräteserie in besonders kompakter Bauweise. Auch wenn auf den
ersten Blick der Eindruck eines sehr aufwendigen und komplizierten
Nachbaus entstehen sollte, täuscht das, da bei einem Großteil der
Schaltung Komponenten in SMD-Ausführung zum Einsatz kommen und diese
bereits werkseitig vorbestückt sind. Der praktische Aufbau ist
übersichtlich und recht schnell erledigt. Zur hohen Nachbausicherheit
tragen auch die übersichtliche mechanische Konstruktion und der
softwaremäßig durchzuführende Abgleich bei. Von Hand zu bestücken sind
nur noch die Bauelemente der Leistungselektronik am Kühlkörper und
wenige Komponenten in konventioneller Ausführung, vorwiegend auf der
Basisplatine. Insgesamt sind im ALC 3000 PC drei Leiterplatten
vorhanden, wobei natürlich der wesentliche Teil der Komponenten auf der
kompakten Basisplatine untergebracht ist. Neben der Basisplatine sind
noch eine Frontplatine mit den Anzeigeund Bedienelementen sowie eine
USB-Schnittstellenplatine zur Kommunikation mit einem PC vorhanden.Bestückung der Basisplatine
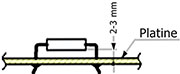
|
| Bild 12: Einbaulage der Leistungswiderstände und Dioden |
Die
Anschlüsse der Widerstände werden auf Rastermaß abgewinkelt, von oben
durch die zugehörigen Platinenbohrungen geführt, an der
Platinenunterseite leicht angewinkelt und verlötet. Danach werden die
überstehenden Drahtenden, wie auch bei allen nachfolgend zu bestückenden
Bauteilen, mit einem scharfen Seitenschneider direkt oberhalb der
Lötstellen abgeschnitten. Im nächsten Arbeitsschritt erfolgt die
Bestückung der Dioden, wobei unbedingt die korrekte Polarität zu
beachten ist. Dioden sind üblicherweise an der Katodenseite
(Pfeilspitze) durch einen Ring gekennzeichnet. Eine Ausnahme bilden hier
die Transil-Schutzdioden (D 300, D 301, D 402), die mit beliebiger
Polarität bestückt werden dürfen. Bei den Dioden D 309 und D 401 ist ein
Leiterplattenabstand von 2 bis 3 mm (wie in Abbildung 12 zu sehen)
erforderlich. 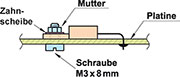
|
| Bild 13: Einbau des Spannungsreglers IC 400 |
Weiter
geht es dann mit dem Einbau der Elektrolyt-Kondensatoren, deren
korrekte Polarität sehr wichtig ist. Falsch gepolte Elkos können
explodieren oder auslaufen. Bei den Elkos ist die Polarität meistens am
Minuspol gekennzeichnet. Die Elkos C 301 und C 400 werden nicht jetzt,
sondern zu einem späteren Zeitpunkt bestückt. Auch der Sound-Transducer
PZ 1 ist gepolt. Das Plussymbol am Bauteil muss mit dem Symbol im
Bestückungsdruck übereinstimmen. Zum Anschluss der Transistoren T 300
und T 400 dienen 3-polige Stiftleisten, die direkt in die zugehörigen
Bohrungen der Platine zu löten sind. 1,3-mm-Lötstifte werden zum
Anschluss des Transistors T 302 und der Diode D 302 im TO-220- Gehäuse
benötigt. Diese Stifte werden ebenfalls von oben in die zugehörigen
Platinenbohrungen gepresst und an der Unterseite sorgfältig verlötet.
Eine danach einzulötende 20-polige Stiftleiste (ST 100) stellt die
Verbindung zur Frontplatine her, eine 4-polige Stiftleiste (ST 103)
dient zum Anschluss der USB-Schnittstelle. Die Stiftleisten müssen vor
dem Verlöten an der Platinenunterseite plan auf der Platinenoberfläche
aufliegen. Im nächsten Arbeitsschritt werden die Klinkenbuchsen BU 200,
die Kleinspannungsbuchse BU 400 und die Western- Modular-Buchse BU 201
eingelötet. Dabei ist zu beachten, dass die Buchsen beim Verlöten plan
aufliegen müssen und keine zu lange Hitzeeinwirkung auf die Bauteile
besteht. Die beiden Platinen-Sicherungshalter SI 300 und SI 400 werden
ebenfalls direkt auf die Leiterplatte montiert. Erst wenn die Halter
plan aufliegen, werden die Anschlüsse unter Zugabe von reichlich Lötzinn
verlötet. Montage des Lüfter-Kühlkörper-Aggregats
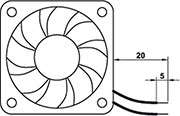
|
| Bild 14: Vorbereiten der Anschlussleitungen des Lüfters |

|
| Bild 15: Am Kühlkörper montierter Lüfter |
Mittels
eines Schraubendrehers dreht man die Schrauben dann mühelos fest. In
die 4 Kühlkörper- Montagebohrungen der Basisplatine werden nun von unten
Schrauben M3 x 6 mm mit je einer Zahnscheibe gesteckt. Auf der
Bestückungsseite folgt eine Isolierplatte aus Leiterplattenmaterial. Die
Schrauben werden danach mit M3-Muttern versehen, die jedoch nur mit
einer Windung aufzuschrauben sind. Alsdann wird der Kühlkörper von
hinten auf die Platine aufgeschoben. Je 2 Muttern verschwinden dabei in 2
Nuten des Kühlkörpers, wobei die Lüfterseite mit den Anschlussleitungen
zur Platine hin orientiert sein muss. Das hintere Ende des Kühlkörpers
muss genau mit der Markierung auf der Leiterplatte am hinteren
Platinenrand abschließen. Danach werden die 4 Schrauben an der
Platinenunterseite angezogen. Die Anschlussleitungen des Lüfters werden
an ST 403 (rote Leitung) und ST 404 (schwarze Leitung) angelötet. 
|
| Bild 16 |

|
| Bild 17: Am Kühlkörper montierte Bauelemente der Lade-/Entladeendstufe und der Lüftersteuerung |
Nun
ist es zweckmäßig, die montierten Komponenten auf eventuelle
Kurzschlüsse zum Kühlkörper hin zu überprüfen. Im Anschluss hieran sind
dann die Anschlussbeinchen der Transistoren und der Diode D 302 mit den
zugehörigen Anschluss- Stiften der Platine zu verlöten. Weitere Bestückung der Basisplatine
Nachdem
das Kühlkörper-Lüfter-Aggregat komplett montiert ist, wird im nächsten
Arbeitsschritt die Speicherdrossel L 300 eingebaut. Die Anschlüsse
dieser Leistungsspule sind zuerst von der Platinenoberseite durch die
zugehörigen Platinenbohrungen zu führen. Bevor das Verlöten der
Anschlüsse an der Platinenunterseite erfolgt, ist die Spule mit einem
hitzebeständigen Kabelbinder festzusetzen. Nach dem Verlöten mit viel
Lötzinn werden an der Platinenunterseite die überstehenden Drahtenden
direkt oberhalb der Lötstellen abgeschnitten.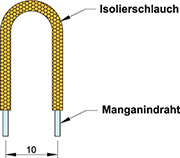
|
| Bild 18: Hochstrom-Shunt-Widerstand R 318 aus Manganindraht |
Der
Quarz Q 100 wird in stehender Position so eingelötet, dass das Gehäuse
auf der Platinenoberfläche aufliegt. Für den weiteren Aufbau werden
Leitungsabschnitte entsprechend Abbildung 19 vorbereitet. Die
Leitungsabschnitte sind entsprechend der angegebenen Längen
abzuisolieren, zu verdrillen und vorzuverzinnen. 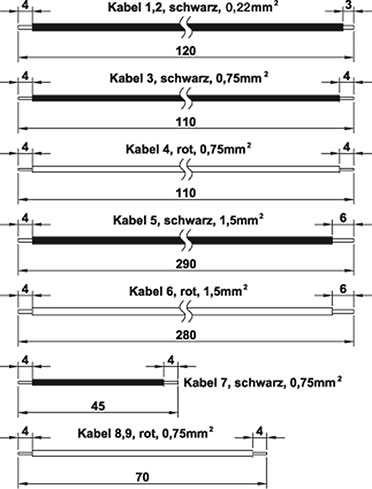
|
| Bild 19: Konfektionierung der verwendeten Anschlussleitungen |
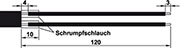
|
| Bild 20: Verlängerung der Temperatursensor-Anschlüsse mit Leitungsabschnitten |
Zur
besseren thermischen Kopplung ist der Sensor an der abgeflachten Seite
leicht mit Wärmeleitpaste zu bestreichen. Die Montage erfolgt danach
mittig auf den Kühlkörper, wozu eine M3-Mutter bis ungefähr zur Mitte in
die entsprechende Nut des Kühlkörpers zu schieben ist. Die Befestigung
am Kühlkörper erfolgt mit einer Metallschelle, einer Schraube M3 x 8 mm,
einer Zahnscheibe und einer Lötöse (die zwischen Metallschelle und
Zahnscheibe zu legen ist). Nun werden die Leitungen des Sensors
verdrillt, von oben durch die zugehörigen Platinenbohrungen (TS 200)
geführt und an der Platinenunterseite verlötet. 
|
| Bild 21: Ansicht der durch den Ferritkern gefädelte Leitungsabschnitte von der Seite |

|
| Bild 22: Auf die Leiterplatte montierte Entstördrossel L 400 |

|
| Bild 23: Durch einen Ferritkern gefädelte Ausgangsleitungen |
Zur
Fixierung der Kabel am Kühlkörper dient die zusammen mit der Schelle
des Kühlkörper-Temperatursensors montierte Lötöse. Hier werden die Kabel
mit einem Kabelbinder befestigt. Anschlussleitung Nummer 8 ist von oben
durch die Platinenbohrung ST 400 und Anschlussleitung 9 in der gleichen
Weise durch die Platinenbohrung ST 402 zu führen und an der
Platinenunterseite zu verlöten. Erst danach sind unter Beachtung der
korrekten Polarität die noch fehlenden Elektrolyt-Kondensatoren C 301
und C 400 einzulöten. Die Basisplatine ist damit bereits vollständig
bestückt. Im nächsten Teil des Artikels beschreiben wir die Bestückung ,
sowie den Zusammenbau der Front- und USBPlatine. 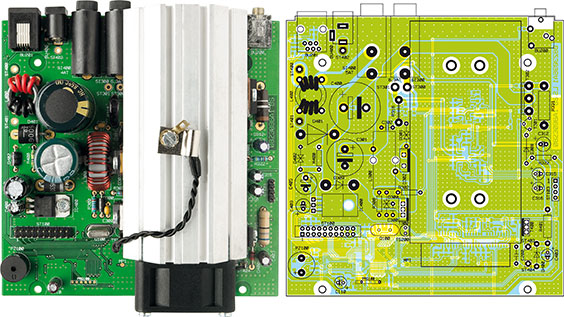
|
| Ansicht
der fertig bestückten Platine (Bestückungsseite) für konventionelle
Bauteile mit zugehörigem Bestückungsplan in verkleinertem Maßstab,
Originalgröße (B x H x T): 150 x 95 x 155 mm. |
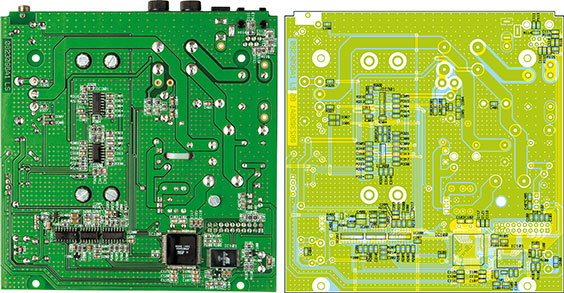
|
| Ansicht
der fertig bestückten Platine (SMD-Seite) mit zugehörigem
Bestückungsplan in verkleinertem Maßstab, Originalgröße (B x H x T): 150
x 95 x 155 mm. |
Fachbeitrag online und als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 2 Versionen:
 als Online-Version
als Online-Version
 als PDF (7 Seiten)
als PDF (7 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Akku-Lade-Center ALC 3000 PC Teil 3/4
| weitere Fachbeiträge | Foren | |
Hinterlassen Sie einen Kommentar:



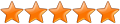
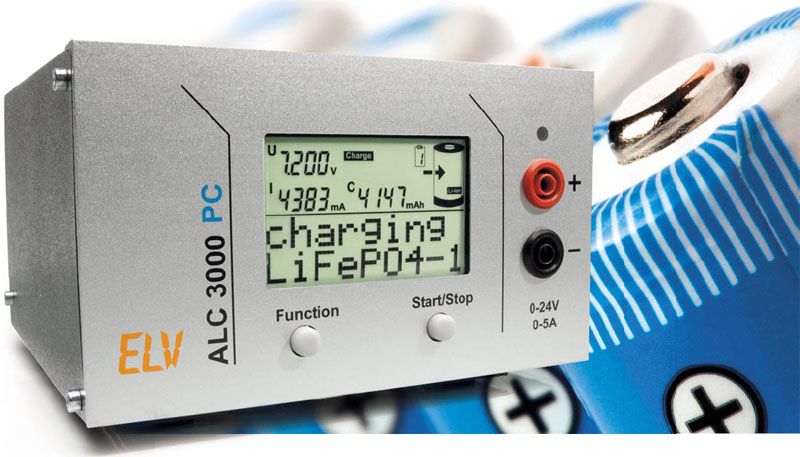







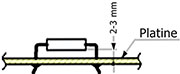
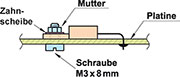
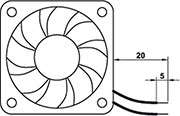



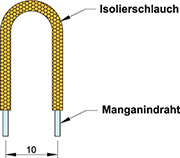
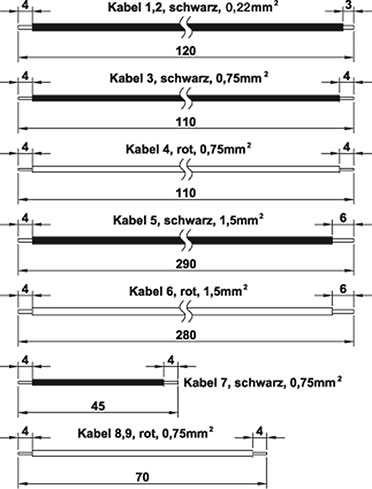
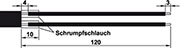



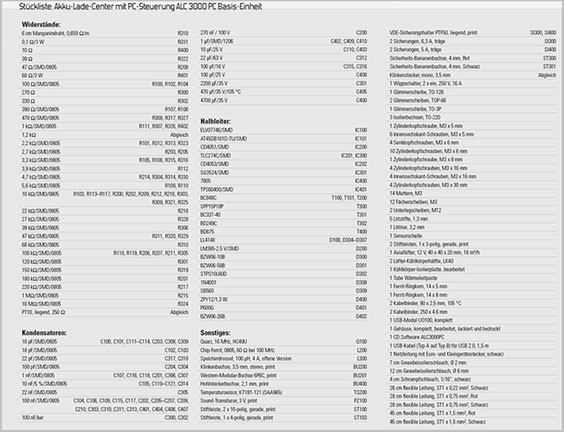
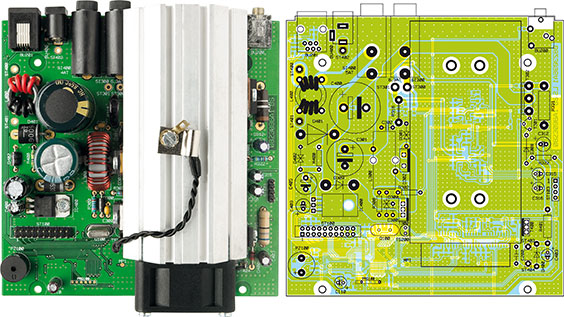
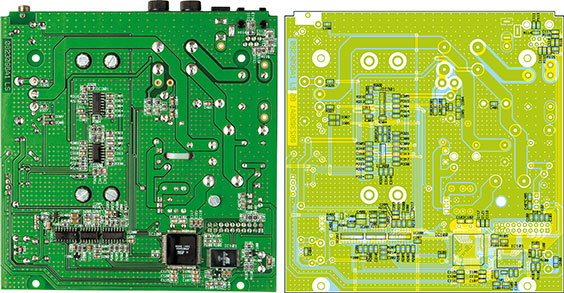
 als Online-Version
als Online-Version als PDF (7 Seiten)
als PDF (7 Seiten)



