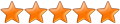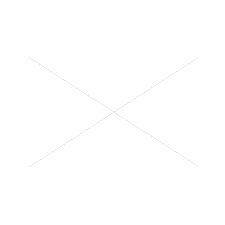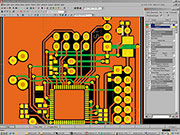Inside ELV – oder wie Qualität entsteht Teil 1/6
Aus ELVjournal
06/2008
0 Kommentare
Rasante 30 Technik-Jahre

|
| Bild 1: Das Cover des ersten Journals aus dem Hause ELV |

|
| Bild 2: Zu ihrer Zeit technisch bahnbrechend – die professionelle Wetterstation WS 7000 |
Hier
gab es aus dem Hause ELV und seiner verbundenen Geschäftspartner immer
wieder innovative Produkte bis hin zu den heutigen hochmodernen
Wetterstationen, die professionell aufbereitete Wettervorhersage-Daten
für mehrere Tage direkt für die Region aus dem Internet, via Satellit
oder Zeitzeichensignal beziehen. Ein Schwerpunkt unserer
Eigenentwicklungen ist und bleibt die Haustechnik. Nach den ersten
Schritten mit solchen Systemen wie FS10, FTP100 und vielen praktischen
Einzelkomponenten gingen wir bereits vor vielen Jahren zur Entwicklung
ganzer Steuerungssysteme für die Haustechnik über. Die sollten jederzeit
erweiterbar, einfach und überall zu installieren sowie im Gegensatz zu
anderen industriellen Systemen erschwinglich und vom Anwender selbst
konfigurierbar sein. Folgerichtig entstand zunächst das nun über viele
Jahre bewährte und mittlerweile über 70 Komponenten umfassende
FS20-System und in dessen „Umfeld” die FHZ-Zentralen, das Warn- und
Meldesystem HMS sowie die Heizungssteuerungen der Reihe FHT und das
Zugangskontrollsystem KeyMatic. Der langjährige Erfolg dieser Systeme
gibt den Visionen der Vordenker recht, endlich gab es das
Jedermann-Haussteuerungs- System, das nicht für jede Änderung den
Fachhandwerker benötigt, selbst in der Mietwohnung, ohne Spuren zu
hinterlassen, installierbar. Auf diesem Erfolg aufbauend, entstand 2007
mit dem gleichen Systemgedanken die nächste Generation, das HomeMatic-
System – bidirektional, noch robuster, noch kommunikativer, aber auch
noch komplexer. Es belegt mit diesen Features auch ein anderes
Preissegment als das überaus preiswerte FS20-System. Und schon jetzt ist
auch Home-Matic ein Renner und findet sich bereits in hohen Stückzahlen
auch als Erst- und Komplettausstattung von Wohn- und Bürohäusern
wieder. Plötzlich sind so 30 Jahre rasanter Elektronikentwicklung herum –
mit der Rechenleistung nahezu jedes aktuellen prozessorgesteuerten
ELV-Gerätes wäre man in den 70ern bequem zum Mond geflogen … Und die 30
Jahre sind nicht spurlos vergangen, aus dem Firmengründer, damals
Student, ist heute ein AG-Vorstandschef mit Professorentitel geworden,
aus der Mini-Firma mit den Wurzeln im Elternhaus ein weltweit agierender
Elektronik- Produzent sowie eines der weltweit größten
Elektronik-Versandhäuser mit Dependancen in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, den USA und China. Neben der Konsumgüterelektronik entstand
auch die Industriesparte mit Zeiterfassungs-, Zugangskontroll- und
Lagerlogistik-Systemen. 
|
| Bild 3: Die neue Firmenzentrale in Leer |
Dem
Wirken der Entwicklungsabteilung wollen wir uns in den folgenden
Beiträgen einmal hautnah widmen und das Entstehen von
Elektronikprodukten von der Idee bis zum verkaufsfertigen Gerät
begleiten. Hirnschmalz für immer Neues
Die
Entwicklungsabteilung besteht aus immerhin über 50 Ingenieuren und
Technikern, sie entwickeln pro Jahr mehrere hundert neue
Elektronikgeräte – vom einfachen Bausatz für Elektronik-Einsteiger bis
hin zur Industrieelektronik. Mit den enormen Produktionskapazitäten der
neuen Fabrik in China, die über 1000 verschiedene Produkte jährlich in
riesigen Stückzahlen fertigen kann, ist die Zahl der neu auf den Markt
kommenden Produkte stetig steigend, unter anderem auch abzulesen an
ständigen Neuausschreibungen von Stellen für Entwicklungs- und
Applikationsingenieure. Demzufolge verkürzen sich auch die
Entwicklungszyklen ständig, weshalb heute bei den meisten Projekten
Spezialisierungen notwendig sind. So entwickelt der eine die Hardware,
während der Softwarespezialist sich der Programmierung der Firmware und
Anwendungssoftware widmet. Der Dritte beschäftigt sich mit dem
Gehäusedesign und der Konstruktion, ein hauseigenes Labor fertigt Hand-
und Erprobungsmuster. Eine ebenfalls hauseigene EMV-Abteilung sorgt
dafür, dass das fertige Produkt zum einen allen gesetzlichen (und auch
international unterschiedlichen) Vorschriften genügt, zum anderen so
betriebssicher ist, dass es weder andere Technik stört noch selbst, z.
B. durch elektromagnetische Einstrahlung, beeinträchtigt werden kann.
Für die Serienfertigung müssen Produktionsunterlagen erarbeitet,
gleichzeitig Bedienungsund Nachbauanleitungen geschrieben werden. Nahezu
alle dieser Schritte, außer der Massenproduktion, erfolgen am Standort
Leer. Hier bildet also die Entwicklungscrew mit all ihren, auch
peripheren Abteilungen und einigen externen Dienstleistern quasi das
Hirn des Konzerns.Von der Ideenliste ins Pflichtenheft
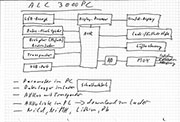
|
| Bild 4: Der typische Ideenzettel mit den allerersten Gedanken zu einem neuen Gerät |

|
| Bild 5: Auf der Entwicklerkonferenz werden Ideen diskutiert sowie die Fahrpläne für die einzelnen Entwicklungen festgelegt. |
Bereits
in dieser Phase trifft das Management die ersten Aussagen zur
Marktfähigkeit der anvisierten Projekte, es wird festgelegt, welche
Projekte wann im „ELVjournal“ detailliert veröffentlicht werden und
welche nicht. Die Marktfähigkeit ist für die meisten Produkte das
„Killer-Kriterium”, schließlich geht es nicht um Selbstverwirklichung im
Hobby, sondern ganz klar um Absatzchancen des Produkts im Markt – die
Frage „Wird es beim Kunden ankommen?” entscheidet alles. Deshalb sind
hier auch das Kunden-Feedback sowie die Erfahrungen der
Marketing-Abteilung gefragt, damit das mit viel Geld fertig entwickelte
und produzierte Gerät letztendlich nicht nach einem Vierteljahr im
Angebot vom Produktmanager den Status „Fertigung einstellen – Abverkauf”
erhält. Diesem Schicksal beugen aber auch die Ingenieure und Techniker
der Entwicklungsabteilung von sich aus vor, indem sie natürlich genau
mit der Ideenfindung den entsprechenden Markt und dessen Entwicklung
beobachten. Und oft wird ja auch nicht das Rad komplett neu erfunden,
schließlich lässt sich auch Bekanntes immer noch deutlich verbessern.
Nehmen wir als Beispiel das Radio-Modul RDS 100. Ein Eigenbau-Radio ist
ja an sich ein alter Hut, aber in dieser Form gab es eben noch keines.
Der Entwickler griff zu einem volldigitalen Konzept, wie man es heute
durchweg in hochwertigen Autoradios findet. Das sichert dem Anwender den
Nachbau und Einsatz ohne die sonst erforderlichen, aufwändigen
Abgleicharbeiten. Das superkompakte Format inklusive Stromversorgung und
Audio-Endstufe an Bord sucht seinesgleichen. Völlig neu ist das
Fernbedienkonzept, das eine komplette Fernbedienung von einem
FS20-Sender erlaubt. Dazu kommt ein modulares Konzept, das eine extrem
hohe Bandbreite an Einsatzfällen möglich macht. Insgesamt ein sorgfältig
durchdachtes, pfiffiges Bausatz-Gerät, das bisher sehr viele Käufer
fand – ergo haben Entwickler und Management in ihren Visionen richtig
gelegen! 
|
| Bild
6: Im Pflichtenheft ist das Gesamtkonzept für eine Entwicklung sehr
detailliert zusammengefasst, es ist die Leitlinie für alle an der
Entwicklung beteiligten Personen. |

|
| Bild 7: Nach der Entwicklerkonferenz geht es an die Schaltungsentwicklung |

|
| Bild 8: Im technischen Layout wird der Schaltplan in ein Platinenlayout umgesetzt. |
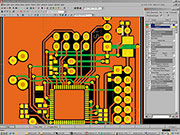
|
| Bild 9: Die Platinenlayouts entstehen mit einem hochmodernen E-CAD-System. |

|
| Bild 10: Auch die Unterlagen zu Standardgehäusen entstehen im technischen Layout. |
Welche
Entwicklung dieses Gebiet in den letzten 30 Jahren genommen hat, zeigt
der Vergleich einer Platinenfolie aus dem ersten „ELVjournal“, die 1978
entstand, mit einer aktuellen aus dem Jahr 2007 (Abbildung 11). 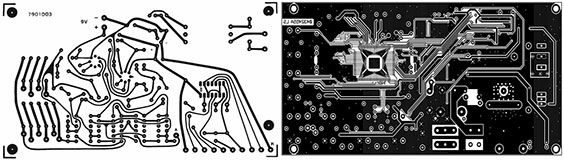
|
| Bild
11: Zwischen der Platinenzeichnung von 1978 (links) und der von 2007
(rechts) liegen fast 30 Jahre Entwicklung in der Technologie der
Platinenherstellung. Während früher Platinen quasi von Hand gezeichnet
wurden, kommt man heute ohne hochentwickelte PC-Programme nicht mehr
aus, zumal heute auch zahlreiche EMV-Vorschriften zu beachten sind. |
Moderne
Bauteile, aktuelle EMV-Anforderungen, hohe Taktfrequenzen und andere
Einflussfaktoren haben die Kunst des Platinen-Layoutens grundlegend
verändert. Solche Platinenlayouts sind, auch wenn die Folien nach wie
vor per Download jedem zur Verfügung stehen, kaum noch in „Heimarbeit”
in eine nutzbare Platine zu verwandeln.
Schließlich entstehen in der
Technik-Layout-Abteilung ebenfalls gleich, sofern das Projekt
veröffentlicht werden soll, weitgehend alle Grafiken für den
entsprechenden Artikel im „ELVjournal“.
Alle Unterlagen, die so nach
und nach entstehen, werden als Projekt im Intranet der Firma abgelegt,
so dass jeder Berechtigte darauf zugreifen kann.
Die Arbeit des
Entwicklers ist aber hier noch lange nicht beendet, im nächsten Teil
unserer Serie nimmt das Projekt erste Formen an, hier kommen u. a. auch
Konstrukteure und Designer ins Spiel.
Fachbeitrag als PDF-Download herunterladen
Inhalt
Sie erhalten den Artikel in 1 Version:
 als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)
Sie erhalten folgende Artikel:
- Inside ELV – oder wie Qualität entsteht Teil 1/6
| weitere Fachbeiträge | Foren | |
Hinterlassen Sie einen Kommentar:
 Videos
Videos
 Foren
Foren
 Technik-News
Technik-News
 Wissen
Wissen
 Fachbeiträge
Fachbeiträge
 Fachmagazin & Abo
Fachmagazin & Abo




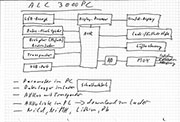



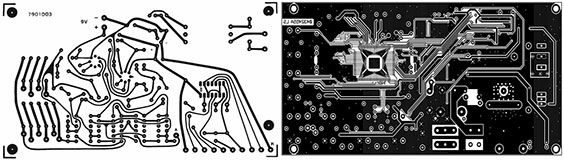
 als PDF (4 Seiten)
als PDF (4 Seiten)